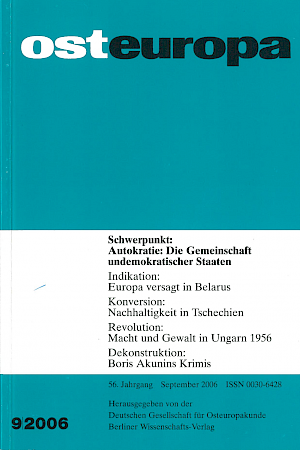Ursprünge und Elemente imitierter Demokratien
Zur politischen Entwicklung im postsowjetischen Raum
Volltext als Datei (PDF, 251 kB)
Abstract in English
Abstract
Das politische System in Rußland ist nicht einzigartig. Auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion haben sich diverse Regime etabliert, in denen hinter einer demokratischen Fassade die Macht in den Händen des jeweiligen Präsidenten konzentriert ist. Ein Vergleich der ostslawischen Staaten mit denen in Mittelasien und im Kaukasus ergibt nicht nur, daß diese imitierten Demokratien denselben Ursprung haben, sondern daß sich diese Ein-Mann-Regime auch derselben Elemente und Praktiken politischer Herrschaft bedienen. Der vermeintlichen Macht und Stabilität zum Trotz sind sie in ihrem Kontrollanspruch, ihrer Legitimationsschöpfung und ihrer sozioökonomischen Leistungsfähigkeit dysfunktional und tragen den Keim des eigenen Untergangs in sich.
(Osteuropa 9/2006, S. 3–24)
Volltext
Alle· ehemals kommunistischen Staaten hatten beim Zerfall des „sozialistischen Lagers“ und der UdSSR gleichlautende Ziele verkündet: Demokratie und Marktwirtschaft. In der Praxis aber ist ihre Entwicklung sehr uneinheitlich verlaufen. Die grundlegenden Unterschiede zwischen Rußland und den ostmitteleuropäischen Staaten einschließlich des Baltikums liegen auf der Hand. In den Ländern Ostmitteleuropas entstanden demokratische Rechtsstaaten westeuropäischen bzw. nordamerikanischen Typs. Verschiedene politische Kräfte unterwerfen sich einheitlichen Spielregeln und lösen einander regelmäßig an der Macht ab. In Rußland hingegen regieren „alternativlose“ Präsidenten, die rechtliche und demokratische Institutionen lediglich zur Tarnung nutzen und die Macht an designierte Nachfolger übergeben. Wer jedoch Rußland nur mit diesen Ländern vergleicht, gerät leicht in Versuchung, die Eigenart der postsowjetischen Entwicklung und des politischen Systems dieses Landes zu überschätzen. Dieses System ist nämlich durchaus nicht einzigartig. Systeme desselben Typs bestehen in vielen asiatischen und afrikanischen Ländern. Auch für die postkommunistische Welt ist Rußlands politische Entwicklung nicht einmalig, ja noch nicht einmal außergewöhnlich. Ähnliche Systeme lassen sich in allen Staaten der GUS beobachten, mit Ausnahme von Moldova und der drei Länder (Georgien, der Ukraine und Kyrgyzstan), in denen sie ihren Lebenszyklus bereits hinter sich haben. Die politischen Entwicklungspfade der GUS-Staaten und die daraus resultierenden politischen Systeme miteinander zu vergleichen, ist eine Aufgabe von kolossaler Komplexität. Der vorliegende Artikel versucht nicht mehr als eine erste, skizzenhafte Annäherung an einen solchen Vergleich. Folgendes will ich darin aufzeigen: · die Rußland und den anderen GUS-Staaten gemeinsamen Voraussetzungen für die Entstehung von Systemen des genannten Typs, · die allgemeine Logik, die deren Entwicklung und · deren Ver- und Zerfall zugrundeliegt, · die Perspektiven, die sich beim Fall solcher Regime auftun, · die Wechselbeziehungen zwischen den verschiedenen Prozessen innerhalb der GUS sowie Möglichkeiten äußerer Einwirkung. Voraussetzungen für das Entstehen „imitierter Demokratien“ Trotz der enormen Diversität politischer Systeme in der modernen Welt gibt es offensichtlich zwei dominante, am weitesten verbreitete Typen: zum einen die in den höchstentwickelten Ländern fest verankerten und auch in vielen weniger entwickelten, früher der „Dritten Welt“ zugerechneten Staaten existierenden wirklichen Demokratien; zum anderen Systeme, die man in Ermangelung eines allgemein anerkannten Begriffes als „gelenkte“ oder „imitierte“ Demokratien bezeichnen kann, also solche, in denen hinter einer rechtsstaatlichen und demokratischen Fassade die Macht in den Händen des Präsidenten konzentriert ist. Solche Systeme bestehen in Rußland und den meisten übrigen GUS-Staaten, aber auch in vielen anderen Ländern. „Imitierte Demokratien“ unterscheiden sich von undemokratischen Systemen anderer Typen: nichtkonstitutionellen Monarchien, die sich auf Tradition stützen; unverhohlenen Diktaturen, welche die Armee als Machtbasis verwenden und auf eine demokratische Fassade verzichten können; sowie totalitären Systemen, in denen die Scheindemokratie auf ein Minimum begrenzt ist, da ihnen ihre eigene Ideologie als Alternative zur Demokratie dient. Allerdings kamen auch die totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts, die kommunistischen und in geringerem Maße auch die faschistischen, nicht ganz ohne eine demokratische Fassade aus. Es gab Wahlen, wenn auch alternativlose, es gab Verfassungen, wenn diese auch grundsätzlich außerrechtliche Bestimmungen enthielten (etwa die über die KPdSU als „führende und richtungweisende Kraft“), es gab Parlamente, wenn sie auch alle Entscheidungen einstimmig absegneten. Die kommunistischen Regime bezeichneten sich als „sozialistische“ bzw. „Volksdemokratien“. Diese systematische Heuchelei der totalitären Regime zeugt davon, daß die totalitären Ideologien selbst in ihrer Blütezeit keine vollkommene Alternative zur demokratischen Legitimation bieten konnten. Heute sind die meisten undemokratischen politischen Regime „imitierte Demokratien“. Dies legt die Vermutung nahe, daß in der heutigen Welt besondere Voraussetzungen für die weite Verbreitung dieses Typs vorliegen. Mit der zweifelhaften Ausnahme des islamischen Fundamentalismus gibt es heute keine ernstzunehmenden ideologischen Alternativen zur demokratischen Gesellschaftsordnung mehr. Die Demokratie ist die einzige verbleibende Legitimationsform politischer Macht. Traditionalistische, undemokratische Regime wie in Saudi-Arabien sind Relikte, die durch günstige Umstände am Leben erhalten werden, aber kein attraktives Modell für andere Länder abgeben. Auch die totalitären kommunistischen Systeme in Nordkorea und Kuba sind Überbleibsel aus dem 20. Jahrhundert, dem Zeitalter der totalitären Ideologien. Militärdiktaturen sind schon ihrem Wesen nach temporäre Ausnahmezustände. Mit der Zeit verwandeln sie sich entweder in reale oder – wenn der Diktator gelenkte Wahlen oder Volksabstimmungen organisiert – in Scheindemokratien. Doch das Fehlen von Ideologien, die ein undemokratisches Regime legitimieren könnten, und die allgemeine Verbreitung einiger demokratischer Ideen und Grundsätze bedeuten nicht, daß alle Gesellschaften demokratiefähig sind. Eine funktionierende Demokratie erfordert entweder bestimmte kulturelle Voraussetzungen oder ein relativ hohes gesellschaftliches und kulturelles Entwicklungsniveau. Wer eine Norm akzeptiert, sie aber nicht befolgen kann, beginnt, sich selbst und andere zu betrügen und ihre Befolgung zu imitieren. Wo sowohl eine ideologische Alternative zur Demokratie als auch die kulturellen und psychologischen Bedingungen für eine funktionierende reale Demokratie fehlen, können politische Systeme entstehen, wie sie auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion verbreitet sind: undemokratische Regime, die Demokratie nachahmen. Genau diese Voraussetzungen lagen in den Ländern der GUS zu Beginn ihrer postsowjetischen Entwicklung vor. Universeller demokratischer Diskurs Zur Zeit des Übergangs vom Kommunismus zum Postkommunismus gab es in den Republiken der ehemaligen Sowjetunion so gut wie keine Alternative zur Idee der Demokratie. Bestimmte demokratische Ideen und Grundsätze hatten sich dank der kommunistischen Ideologie eingebürgert. Die Vorstellung, die Macht müsse vom Volk ausgehen, gewählt sein und „dem Volk dienen“, waren für die Menschen in der UdSSR ebenso selbstverständlich wie die Notwendigkeit von Wahlen und einer Verfassung. Eine natürliche Form des Protests gegen die Sowjetmacht war die Anprangerung des Demokratiemangels, der Hinweis auf die Diskrepanz zwischen den verkündeten Grundsätzen und der Wirklichkeit. Deshalb wurde nach dem Fall des Sowjetregimes überall der Versuch unternommen, zu einer echten Demokratie überzugehen, indem die formellen Institutionen der sowjetischen Demokratie mit realer Substanz gefüllt werden sollten. Auch später entstanden keine ideologischen Alternativen zur Demokratie: In allen GUS-Ländern bewegt sich die Auseinandersetzung zwischen den Präsidenten und der Opposition im Rahmen eines demokratischen Diskurses. Faktisch wird nur eine ideologische Begründung der autoritären Regime in der GUS vorgebracht: Gejdar Aliev, Askar Akaev, Nursultan Nazarbaev, Saparmurad Nijazov und – in abgeschwächter Form – Vladimir Putin sprechen ständig davon, „unsere Länder“ seien für eine vollwertige Demokratie noch nicht reif und befänden sich noch auf dem Weg dorthin, daher solle man sie nicht mit westlichen Maßstäben messen und drängen, sonst drohe die gesamte Entwicklung zu scheitern. In keinem Land der GUS würde der Herrscher auch nur auf die Idee kommen, ganz auf demokratische Legitimation zu verzichten. Zwar können Wahlen auf ein Ritual reduziert werden, aber ohne dieses Ritual kommt kein Regime aus. Zwar können Verfassungen als Feigenblatt dienen, aber ohne ein solches Feigenblatt traut man sich nicht unters Volk. Doch trotz dieses universellen demokratischen Diskurses gab es in den zwölf Ländern der GUS in den 15 Jahren seit dem Ende der Sowjetunion nur fünf Fälle einer friedlichen, verfassungsgemäßen Machtübergabe an die Opposition. Drei davon entfallen auf Moldova, dessen Entwicklung sich grundlegend von jener der anderen Länder unterscheidet. In den zwei anderen Fällen machten sich die neuen Präsidenten sofort daran, ein eigenes „alternativloses“ Regime zu errichten: Aljaksandar Lukašėnka als Nachfolger von Vjačeslav Kebič in Belarus und Leonid Kučma als Nachfolger von Leonid Kravčuk in der Ukraine. Die durchgehende Berufung auf demokratische Werte geht Hand in Hand mit einer durchgehend undemokratischen Entwicklung. Demokratische Grundsätze sind zwar akzeptiert, werden aber nicht befolgt. Woran liegt das? Präzedenzlosigkeit Dieser Sachverhalt kann nicht mit dem „schweren sowjetischen Erbe“ erklärt werden. In den ostmitteleuropäischen und baltischen Ländern sind trotz der kommunistischen Vergangenheit demokratische Gemeinwesen entstanden. Die Gesellschaften in den kommunistischen Ländern entwickelten sich in dieselbe Richtung wie der Rest der Welt, wenn auch langsamer und auf eigentümliche Weise. Deshalb waren beim Fall dieses Systems alle ehemals kommunistischen Länder im großen und ganzen demokratiebereiter als zum Zeitpunkt seiner Entstehung. Die mangelnde Demokratiebereitschaft der vom Kommunismus befreiten Länder der GUS hat weniger mit dem Erbe dieses Systems zu tun als mit tieferen kulturellen und historischen Gründen. Ohne auf die grundlegendsten kulturellen Faktoren einzugehen, die der Demokratisierung der GUS-Länder im Wege stehen, möchte ich hier einige auf der Hand liegende Umstände aufzählen. Zunächst einmal konnte keines dieser Länder, anders als die ostmitteleuropäischen Staaten, beim Aufbau eines postsowjetischen demokratischen Systems auf historische Demokratieerfahrungen zurückgreifen. Die Demokratisierungsbemühungen nach 1917 waren so kurzlebig und erfolglos gewesen, daß die postsowjetische Erfahrung praktisch als der erste Versuch gelten kann. Hingegen haben einige Länder, vor allem Rußland und Uzbekistan, eine starke autoritäre Tradition, die im Bewußtsein ihrer jeweiligen Bevölkerung verankert ist. Im historischen Rückblick läßt sich Rußlands Größe nicht von Persönlichkeiten wie Ivan dem Schrecklichen, Peter dem Großen und Stalin trennen. Der usbekische Nationalstolz kristallisiert sich um die Gestalt Tamerlans. Keines der GUS-Länder kann ein klares Demokratiemodell aus seiner Geschichte schöpfen; aber auch unter kulturell verwandten Ländern finden sich keine Vorbilder. Selbstverständlich übte und übt das Vorbild der europäischen und amerikanischen Demokratien einen kolossalen Einfluß aus. Doch sind diese Staaten kulturell sehr weit von den GUS-Ländern entfernt und haben daher nicht dieselbe Vorbildfunktion wie sie Finnland und Schweden für Estland und Lettland hatten. Für die turksprachigen islamischen Länder der GUS kann zwar das Beispiel Türkei eine bestimmte Rolle spielen, doch ist die Türkei nicht gerade eine vorbildlich stabile und entwickelte Demokratie. Überdies konkurriert das türkische Modell mit denjenigen der anderen islamischen Länder. In kultureller Hinsicht sind die GUS-Staaten immer noch weitgehend von Rußland abhängig, das wahrlich nicht als Beispiel für eine geglückte Demokratisierung dienen kann. Es ist vollkommen natürlich, daß die Präzedenzlosigkeit der Demokratie, der Mangel an Demokratieerfahrung und das Fehlen klarer Vorbilder eine Demokratisierung erschweren. Noch komplizierter aber wird dieser Prozeß dadurch, daß er zeitlich mit zwei anderen, ebenfalls sehr schwierigen Übergängen zusammenfällt. Dies ist zum einen der Übergang von einem sozialistischen Wirtschaftssystem zur Marktwirtschaft. Der mehr als zwei Generationen währende Sozialismus hatte die Menschen von marktwirtschaftlichen Institutionen und Privateigentum entwöhnt. Daher war die Einführung des Marktes in den GUS-Staaten eine fast ebenso unerhörte Aufgabe wie die Demokratisierung. Zum zweiten ist es der Übergang vom sowjetischen Imperium zu modernen Nationalstaaten: für die Bevölkerung der GUS-Staaten, anders als für die Ostmitteleuropas, ebenfalls ein Novum (auch hier wieder mit Ausnahme einiger erfolgloser Versuche während des rußländischen Bürgerkriegs). Zählt man den raschen und unerwarteten Zerfall der UdSSR hinzu, wird klar, daß die Völker der GUS 1991 Menschen ähnelten, die plötzlich ins Wasser geworfen werden, obwohl sie nicht schwimmen können und Schwimmende zuvor nur von fern beobachten konnten. Selbst wenn sie verstehen, daß sie schwimmen müssen, und sich redliche Mühe geben, können solche Menschen leicht in Panik und Verzweiflung geraten. Die politischen Regime in den GUS-Staaten Beim Fall der UdSSR erklärten alle GUS-Staaten, demokratische Rechtsstaaten errichten zu wollen. Auf dem gesamten Gebiet der GUS entstand ein Chaos, das in abgeschwächter Form dem Zustand des Russischen Reiches nach dem Ende der Zarenherrschaft glich. Die schreckliche wirtschaftliche Lage, die in den GUS-Ländern zu Beginn der 1990er Jahre entstand, braucht wohl ebensowenig erwähnt zu werden wie die Kriege, Aufstände und Coups, die zu dieser Zeit das Gebiet der ehemaligen Sowjetunion erschütterten. In einigen Ländern lösten sich die staatlichen Strukturen so vollständig auf, daß Kriminelle an die Macht kamen: Sangak Safarov in Tadžikistan, Tengiz Kitovani und Džaba Ioseliani in Georgien sowie Suret Gusejnov in Azerbajdžan. Angesichts dieser Lage war das Verlangen der Bevölkerung nach „Ordnung“ vollkommen natürlich. Die Einstellung der gesamten GUS-Bevölkerung läßt sich an den Ergebnissen einer Umfrage in Kazachstan aus dem Jahr 1998 ablesen. Gefragt wurde, welches System die Probleme der kasachstanischen Gesellschaft zu lösen vermag. 4,4 Prozent der Befragten nannten als Antwort den Kommunismus, 7,3 Prozent den Sozialismus, 5,9 Prozent den Kapitalismus, 2,8 Prozent die „Demokratie westlichen Typs“ und 2,3 Prozent den Islam. 56,9 Prozent antworteten: „Egal, Hauptsache, es herrscht Ordnung.“ Die Menschen verspüren eine Nostalgie nach den ruhigen Zeiten vor der Revolution, die allerdings nicht in bewußte Versuche einer Wiederherstellung des sowjetischen Systems mündet – denn die kommunistische Ideologie ist tot – und auch nicht zur Verbreitung anderer antidemokratischer Ideologien führt, die in der modernen Kultur schlicht nicht mehr vorhanden sind. Ein gewisses Maß an Chaos ist bei jedem politischen und gesellschaftlichen Systemwechsel natürlich. Ebenso natürlich ist das Aufkommen einer nostalgischen Verklärung der verschwundenen Ordnung. Eine solche Überbewertung der Vergangenheit entsteht in allen Ländern, die antikommunistische Revolutionen hinter sich haben. Doch je nach Intensität dieser Nostalgie (und der sie hervorrufenden Schwierigkeiten) stellen sich grundsätzlich verschiedene Folgen ein. In Ländern, die besser als die Staaten der GUS auf eine demokratische Entwicklung vorbereitet waren, führt dies zu einer Wahlniederlage der radikalen Kräfte, die in den Jahren der Revolution an der Macht waren, und zum Machtantritt gemäßigter, mit der alten Elite verbundener Figuren, die der kommunistischen Ideologie abgeschworen haben. Die markantesten Beispiele sind der Wahlsieg von Algirdas Brazauskas über die Sąjūdis-Bewegung in Litauen und die Abwahl von Lech Wałęsa zugunsten von Aleksander Kwaśniewski in Polen. Dieser erste demokratische Machtwechsel verwandelt die Herrschaft siegreicher Demokraten definitiv in eine Herrschaft der Demokratie und des Rechts und führt zur Herausbildung eines Systems, in dem turnusmäßige Regierungswechsel die Norm sind. Liegen dieselben Faktoren in einem etwas anderen Verhältnis vor – ein wenig mehr revolutionsbedingte Anarchie, ein etwas stärkerer Ruf nach einem Ende dieser Anarchie und eine etwas geringere Demokratiebereitschaft –, so zeitigt dies ganz andere Folgen. Statt regelmäßiger Regierungswechsel und einer Stärkung der Demokratie durch den Wahlsieg von Erben der „vorrevolutionären“ Vergangenheit erfolgt die Festigung des bestehenden Regimes. Ein Machtwechsel wird dadurch ausgeschlossen, das Regime selbst nimmt „vorrevolutionäre“ autoritäre Züge an: Es entstehen „imitierte Demokratien“. Grundlage dieser Systeme sind die Manipulation der öffentlichen Meinung und die Fälschung der Willenserklärungen des Volkes. Doch ohne eine entsprechende Nachfrage aus der Gesellschaft, ohne ihre Zustimmung zu Manipulation und Fälschung könnten solche Systeme nicht entstehen. Selbstverständlich hätte die ungewisse Krisensituation Anfang der 1990er Jahre in verschiedenen GUS-Staaten zu verschiedenen Ergebnissen führen können; die schließlich entstandenen „imitierte Demokratien“ waren nicht der einzig mögliche Ausgang. Doch die Chancen der GUS-Länder, zu wirklichen Demokratien zu werden, waren damals wohl minimal. Am besten standen sie wahrscheinlich in der Ukraine und Belarus, wo immerhin friedliche Machtwechsel stattfanden. Daß dort keine demokratischen Rechtsstaaten entstanden, hing ganz entscheidend mit den Persönlichkeiten Kučmas und Lukašenkas zusammen. „Imitierte Demokratien“ waren das wahrscheinlichste und natürlichste Resultat dieser Konstellation. Der Charakter der Machthaber, ihr Werdegang (Boris El’cins Antikommunismus und Lukašenkas Kommunis-mus-Nostalgie, Ter-Petrosjans Intellektualität und Rachmonovs „Schlichtheit“) und die Schattierungen ihrer Ideologien gaben den jeweiligen Regimen eine bestimmte Färbung, hatten jedoch kaum Einfluß auf deren Wesen und Entwicklungslogik. Von der Entwicklungslogik zur Handlungslogik Das Bedürfnis der Bevölkerung, die Revolutionswirren zu überwinden, begünstigt die Entstehung „imitierter Demokratien“. Ein weiterer Faktor ist jedoch die Handlungslogik, von der sich die Präsidenten leiten lassen. Ein Ein-Mann-Regime, das Demokratie nur imitiert, kann nicht auf rechtlichem Wege eingeführt werden. Es wird mit ungesetzlichen Mitteln durchgesetzt. Je weiter aber ein Präsident sein Regime auf diese Art ausbaut, desto sicherer drohen ihm nach dem Verlust der Macht rechtliche Konsequenzen. In Rußland hatte El’cin ohne ein entsprechendes Mandat des Volkes (oder sogar trotz eines genau gegensätzlichen Mandats) mit der Unterzeichnung des Belovežer Abkommens den Zerfall der UdSSR besiegelt. Allein dadurch erschwerte er sich die Abgabe der Macht bereits ungemein. Denn jetzt konnte es sich die Opposition nicht nehmen lassen, ihn für die „Zerstörung eines großen Staates“ verantwortlich zu machen; wäre sie an die Macht gekommen, wäre ihm ein Gerichtsprozeß wohl kaum erspart geblieben, wobei die Anklagepunkte von Kompetenzüberschreitung bis hin zu Hochverrat gereicht hätten. Wäre El’cins persönliche Sicherheit bei einem Abtritt im Jahr 1992 oder Anfang 1993 vielleicht noch gewährleistet gewesen, so war dies nach der blutigen Auflösung des Parlaments im Oktober 1993 schlicht nicht mehr möglich. Dieselbe Logik scheint auch in den Handlungen und Motiven anderer Staatsoberhäupter durch. Der Maßnahmenkatalog eines Präsidenten, der sich zur Errichtung eines „alternativlosen“ Regimes entschlossen hat, beinhaltet die Abschaffung der gültigen Verfassung und die Einführung verfassungswidriger Gesetzgebung, Manipulationen von Wahlergebnissen und Volksentscheiden, Druck auf die Gerichte, an den Haaren herbeigezogene Strafprozesse gegen politische Gegner usw., bis hin zum „mysteriösen“ Verschwinden Oppositioneller und deren Ermordung. Neben Verbrechen, die unmittelbar der Festigung des Regimes dienen, wurden auch im Zuge der Privatisierungen zahlreiche Straftaten begangen. Da die Behörden gänzlich unbeaufsichtigt agierten, arteten diese Vorgänge unvermeidlich in eine Plünderung des Staatseigentums aus, an dem auch die Präsidenten persönlich und ihr jeweiliges Umfeld beteiligt waren. Deshalb gilt: Je weiter das Ein-Mann-Regime gefestigt und ausgebaut wird, desto schwieriger wird es für den Präsidenten, vom einmal gewählten Weg wieder abzuweichen, und desto wahrscheinlicher wird es, daß ihn und seine Getreuen nach seinem Abgang Prozesse, Haft und Ruin erwarten – es sei denn, er übergibt die Macht an einen vorsorglich ausgewählten Nachfolger und sichert sich Immunität vor rechtlichen Verfolgungen. Es ist sehr leicht, diesen Weg zu beschreiten, aber fast unmöglich, ihn wieder zu verlassen. Die Ein-Mann-Regime durchliefen in den verschiedenen GUS-Ländern ähnliche Phasen und entwickelten sich in ähnlichen Formen. Betrachten wir einige dieser Phasen näher. Konflikte mit den Parlamenten und Auflösung unkontrollierbarer Parlamente El’cins blutiger Konflikt mit dem Parlament im Jahr 1993 war der wichtigste Meilenstein in der Entwicklung eines autoritären Regimes in Rußland. Es war aber nicht die einzige Auseinandersetzung dieser Art in der GUS. In der ersten Hälfte der 1990er spielten sich in allen Ländern der GUS Konflikte zwischen den Präsidenten und den Parlamenten ab – mit Ausnahme Turkmenistans, wo das Parlament von Anfang an vollkommen dem Präsidenten unterstellt war. Der Grund für diese Konflikte war, daß die ersten Parlamente noch zu Michail Gorbačevs Zeiten gewählt worden waren, als die Behörden nur minimalen Einfluß auf die Wahlen ausübten und die Gesellschaft von einer Welle der Demokratie ergriffen war. Die Parlamente waren noch nicht „lenkbar“, die Abgeordneten hatten eine hehre Vorstellung von ihrer Mission, und die Parlamentspräsidenten waren von der hohen Bedeutung ihrer Funktion überzeugt. Die Parlamente waren das größte Hindernis auf dem Weg zur Festigung der Präsidialmacht und zur Errichtung eines autoritären Systems. Die Auseinandersetzungen zwischen den Präsidenten und den Parlamenten wurden dadurch verschärft, daß in den GUS-Staaten noch die alten sowjetischen Verfassungen – mit zahlreichen Korrekturen – Gültigkeit hatten und die Aufteilung der Kompetenzen zwischen den Gewalten völlig unklar war. In dieser Situation eskalierte der Konflikt zwischen Präsidenten und Parlamenten in Anarchie. Die Abgeordneten standen den Wählern näher als die Präsidenten und deren Entourage. Daher konzentrierte sich in den Parla-menten allerorts die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit den marktwirtschaftlichen Reformen. Allerdings war das Verlangen nach Ordnung stärker als der Protest gegen die Reformen, weshalb die Bevölkerung in den Konflikten zwischen Präsidenten und Parlamenten eher die Präsidenten unterstützte: Diese standen für Ordnung, wogegen die Parlamente das Chaos der Demokratie symbolisierten. Nur in Rußland spielte sich ein solcher Konflikt in blutiger Form ab. In Kazachstan löste der Präsident das Parlament ohne Gewaltanwendung auf, dafür gleich zweimal in Folge (1993 und 1994). Auch in Kyrgyzstan (1995) und Belarus (1996) wurde das Parlament aufgelöst. Moldova, mit seiner generell sehr eigenwilligen politischen Entwicklung, ist das einzige Land, in dem der Konflikt zwischen den Präsidenten (zuerst Mircea Snegur, dann Petru Lucinschi) und dem Parlament in einer Niederlage der Präsidialmacht und der Errichtung einer parlamentarischen Republik mündete. Beseitigung alter Weggefährten Ein Teilaspekt von Boris El’cins Auseinandersetzung mit dem Parlament war sein persönlicher Konflikt mit dessen Vorsitzendem Ruslan Chasbulatov und dem Vizepräsidenten des Landes, Aleksandr Ruckoj, der sich auf die Seite des Parlaments geschlagen hatte. Auch dazu gab es in anderen Ländern Parallelen: In Kazachstan kollidierte Nursultan Nazarbaev mit dem Parlamentspräsidenten Serikbolsyn Abdil’din und setzte den Vizepräsidenten des Landes, Ėrik Asanbaev, ab. In Kyrgyzstan und Uzbekistan prallten die Präsidenten Askar Akaev und Islam Karimov mit ihren jeweiligen Vizepräsidenten, Feliks Kulov und Šukurullo Mirsaidov, zusammen. In Azerbajdžan gab es einen Konflikt zwischen Gejdar Aliev und dem Vorsitzenden des Parlaments, Rasim Kuliev. Und in Belarus überwarf sich Aljaksandar Lukašenka mit vielen seiner einstigen Unterstützer. Alle diese Konflikte laufen nach ein und demselben psychologischen Muster ab. Dieses ist typisch für die Entstehungsphase autoritärer Regime. Zunächst ist der Präsident von Menschen umgeben, die mit ihm zusammen um die Macht gekämpft haben und ihn als Ersten unter Gleichen statt als Chef ansehen. Unvermeidlich verdrängt das entstehende autoritäre System diese Figuren, da sie sich schwer tun, sich von Mitstreitern zu Gefolgsleuten zu wandeln. (Bei allen offensichtlichen Unterschieden laufen diese Konflikte nach dem gleichen Muster ab wie der zwischen Hitler und Röhm sowie die zwischen Stalin und später Chruščev und den anderen Mitgliedern des Politbüros.) Verabschiedung neuer Verfassungen Der Sieg über das Parlament ermöglicht es dem Präsidenten, eine neue Verfassung durchzusetzen, die ihm weitestgehende Befugnisse einräumt und die Kompetenzen der anderen Gewalten einschränkt. Dank dieser Verfassungen können die Ein-Mann-Regime funktionieren, ohne ständig gegen verfassungsrechtliche Bestimmungen zu verstoßen. Sie erhalten dadurch quasirechtliche Formen. Die Präsidenten bemühen sich sogar, sich vor bloß denkbaren Gefahren zu schützen: So ist in den Verfassungen von Turkmenistan und Uzbekistan zum Beispiel gar kein Amtsenthebungsverfahren für den Präsidenten vorgesehen, während dieses in Rußland und Kazachstan bis zur Undurchführbarkeit erschwert ist. Bezeichnenderweise ist in keiner Verfassung eines GUS-Staates das Amt eines Vizepräsidenten vorgesehen: Die Präsidenten sind nicht mehr bereit, neben sich einen weiteren vom Volk gewählten Amtsträger zu dulden, und wollen bei der Auswahl ihres Nachfolgers freie Hand behalten. Da die Bestimmungen der neuen Verfassungen den Ein-Mann-Regimen genehm sind, tendieren diese zu einer „Sakralisierung“ dieser Texte. Dies steht in krassem Widerspruch zum leichtfertigen Umgang derselben Präsidenten mit den vor der Verabschiedung der neuen Gesetze gültigen Verfassungsnormen. Ein-Mann-Regime sind grundsätzlich keine Rechtsstaaten. Nach jeglichen „Spielregeln“, auch solchen, die der Präsident selbst eingeführt hat, könnte irgendwann jemand anderer gewinnen. Deshalb bleibt auch eine auf Anweisung des Präsidenten aufgesetzte Verfassung eine bloße Form, die jederzeit geändert oder einfach zur Seite gefegt werden kann. So begrenzten zum Beispiel alle Verfassungen zunächst die Amtsdauer des Präsidenten. Später wurden die entsprechenden Artikel geändert. In Tadžikistan etwa wurde 1999 eine Verfassungsänderung verabschiedet, die die Amtsdauer von fünf auf sieben Jahre verlängerte; 2003 erlaubte es eine weitere Änderung dem Präsidenten, zweimal sieben Jahre zu regieren. Auch in Uzbekistan und Belarus wurden Verfassungsänderungen beschlossen, welche die Amtsdauer des Präsidenten verlängerten und seine unbegrenzte Wiederwahl ermöglichten. Ein markantes Beispiel für den Umgang der Präsidenten mit den Verfassungen liefert Kazachstan. Dort verabschiedete das Parlament 1993 eine Verfassung, die Nazarbaev nicht genehm war. Daraufhin löste er die Volksvertretung verfassungswidrig auf. Doch auch mit dem neugewählten Parlament war der Präsident nicht zufrieden und löste es 1994 wiederum auf. 1995 wurde unter Mißachtung der Verfassung eine Volksabstimmung über die Verlängerung der Amtsdauer des Präsidenten bis 2000 durchgeführt, etwas später in einem weiteren Referendum eine neue Verfassung angenommen, die im Präsidialapparat konzipiert worden war und für diesen daher eigentlich ideal hätte sein müssen. Angesichts einer für ihn günstigen politischen Konjunktur beschloß Nazarbaev bereits 1998, nicht das Ende der ihm per Volksentscheid zugebilligten Amtszeit abzuwarten, sondern er rief Neuwahlen aus, was sowohl gegen die neue Verfassung als auch gegen das Ergebnis der Volksabstimmung verstieß. Darüber hinaus wurden mehrere Verfassungsänderungen verabschiedet, die unter anderem die Altersbeschränkung für das Amt des Präsidenten aufhoben und seine Amtszeit verlängerten. Somit war und ist Nazarbaev unter drei Verfassungen im Amt – und hat gegen alle drei verstoßen. Methoden der Machtsicherung Die Verfassung kleidet das Ein-Mann-Regime äußerlich in relativ stabile Formen. Doch um es aufrechtzuerhalten, bedarf es der systematischen Unterbindung jeglicher Versuche oppositioneller Kräfte, das Regime zu destabilisieren. Potentielle Gefahren müssen rechtzeitig erkannt und abgewendet werden. Die vielfältigen Methoden und Maßnahmen, mit denen in den GUS-Staaten politische Stabilität erzeugt und aufrechterhalten wird, können hier nicht erschöpfend dargelegt werden. Deshalb seien nur die wichtigsten genannt. · Kontrolle über die Medien. Am wichtigsten ist hier das Fernsehen als das effektivste Massenmedium mit der größten Reichweite. · Verabschiedung zweckdienlicher Wahl- und Parteigesetze. Die Registrierung von Parteien wird behindert oder gar verweigert. Hohe Prozenthürden erschweren den Einzug bestimmter Parteien ins Parlament. Des weiteren werden Gesetze verabschiedet, die es ermöglichen, unerwünschte Kandidaten von Wahlen auszuschließen. So ermächtigte ein Erlaß des Präsidenten von Kazachstan aus dem Jahr 1998 die Gerichte, jeden Kandidaten von den Wahlen auszuschließen, der innerhalb eines Jahres vor dem Wahltag einen Verstoß gegen das Verwaltungsrecht begangen hatte. Daraufhin wurde Nazarbaevs wichtigster Rivale, Akežan Kažegel’din, aus dem Rennen genommen. · Kontrolle über die Wahlkommissionen und systematische Wahlmanipulation. Alle Ein-Mann-Regime in der GUS manipulieren Wahlergebnisse. In Ländern wie Turkmenistan und Uzbekistan ist „Manipulation“ inzwischen das falsche Wort, da die Wahlen dort so unfrei und ritualisiert sind, daß es dafür keinen Bedarf gibt. In anderen Ländern nutzt das Regime während des gesamten Wahlkampfs und der Wahlen, einschließlich der Stimmauszählung, aktiv seine „administrativen Ressourcen“. Manipuliert wird selbst dann, wenn klar ist, daß das tatsächliche Ergebnis der Abstimmung den Wünschen des Präsidenten entspricht, denn die Verantwortlichen vor Ort konkurrieren darum, welcher Bezirk das beste Resultat vorweisen kann. So stimmte zwar sowohl bei der Volksabstimmung von 1996 als auch bei den Wahlen im Jahr 2006 ohne Zweifel eine Mehrheit der Belarussen für Lukašenka, ebenso zweifellos aber waren die Ergebnisse trotzdem manipuliert. · Gründung von Pro-Präsidenten-Parteien. Alle zu Beginn der 1990er in der GUS existierenden Parteien waren unabhängig von den jeweiligen Machthabern entstanden. Ist aber ein Präsident Mitglied in einer Partei, die er nicht selbst gegründet hat und die in Ideologie und Programmatik von ihm unabhängig ist, so wird ihm diese unvermeidlich die Hände fesseln. Deshalb di-stanzieren sich die Staatsoberhäupter meist in einem frühen Stadium ihres Regimes von allen Parteien und gerieren sich als Präsidenten des ganzen Volkes. Die Ausnahmen sind Turkmenistan und Uzbekistan, deren Präsidenten auf der Grundlage der KPdSU-Parteiorganisationen sofort „eigene“, vollkommen unter ihrer persönlichen Kontrolle stehende Parteien gründeten. Doch mit der Zeit steigt das Bedürfnis nach Parteien als Mechanismen zur Loyalitätsprüfung, Personalauswahl und zusätzlichen Steuerung. Es werden Pro-Präsidenten-Parteien gegründet, deren Ideologie und Programm sich im wesentlichen auf die Unterstützung des Regimes beschränkt. In Rußland ist dies Edinaja Rossija (Einiges Rußland), in Kazachstan Otan (Vaterland), in Azerbajdžan Yeni Azerbaycan (Neues Azerbajdžan) und in Tadžikistan Hizbi Demokrati-Chalkii Todžikiston (Demokratische Volkspartei). Dabei kann durchaus mit Pseudo-Mehrparteiensystemen experimentiert werden. So gibt es in Kazachstan neben Otan zwei „zusätzliche“ Präsidentenparteien (die Bürgerliche und die Agrarpartei). Auch können neue entstehen (Asar, „Alle Zusammen“). So wird die Illusion einer breiten Parteienvielfalt erzeugt. Auch in Uzbekistan gibt es ein Mehrparteiensystem, in dem die Parteien einander in Loyalitätsbekundungen an den Präsidenten zu überbieten suchen. Privatisierung und Macht Die Errichtung und Aufrechterhaltung eines Ein-Mann-Regimes ist nicht nur ein politischer Prozeß. Er hat auch soziale und ökonomische Aspekte. Die Privatisierung von Staatseigentum in fast allen GUS-Staaten in den 1990er Jahren hatte soziale, wirtschaftliche und eine politische Bedeutung. Auch sie diente der Festigung des Ein-Mann-Regimes. Da es so gut wie überhaupt keine gesellschaftliche Kontrolle über die Privatisierungen gab, gerieten diese zu einer von zahlreichen Rechtsbrüchen begleiteten „Verteilung“ von Staatseigentum durch die Exekutive. Daher lag es im Interesse der neuen Eigentümer, die Machthaber gütig zu stimmen: Davon hing ab, ob man zum Millionär „ernannt“ wurde. Außerdem waren sie daran interessiert, das Regime aufrechtzuerhalten: Nach einer Machtübernahme durch die Opposition konnten Privatisierungen rückgängig gemacht werden (was nach den „farbigen Revolutionen“ in Georgien und der Ukraine teilweise auch geschah). Dies gab den Präsidenten Kontrollmittel über die Eigentümer in die Hand: Beim leisesten Anzeichen von Illoyalität konnten die Präsidenten Ermittlungsverfahren zu deren Wirtschaftstätigkeit oder zu Unregelmäßigkeiten während der Privatisierungen (die sie damals selbst gefördert hatten) anordnen und ihre Gegner so aufgrund rein wirtschaftlicher Vergehen verfolgen. Solche Prozesse um reale oder imaginäre Straf- bzw. Wirtschaftsdelikte liefen in Rußland (gegen Boris Berezovskij, Vladimir Gusinskij und Michail Chodorkovskij), Kyrgyzstan (gegen Feliks Kulov), Azerbajdžan (gegen Rasul Kuliev), Kazachstan (gegen Akežan Kažegel’din, Galymžan Žakijanov und Muchtar Abljazov) und Belarus (gegen Andrej Klimov u.a.). Ein-Mann-Regime können kein normales rechtliches Umfeld für eine Marktwirtschaft aufbauen. Sie sind aber auch gar nicht daran interessiert, denn das käme einem Verlust ihrer Kontrolle über die Wirtschaft gleich, was ihnen wiederum die Kontrolle über die Gesellschaft als ganzes, einschließlich der Politik, entziehen könnte. Kontrolldynamik und Eigendynamik Mit Hilfe dieser und anderer Mittel werden Ein-Mann-Regime errichtet und gefestigt. Die Logik ihrer Handlungen treibt die Präsidenten zur Errichtung einer immer größeren Kontrolle über die Gesellschaft. Am wichtigsten ist es, die Alternativlosigkeit des Präsidenten zu betonen. Dies führt unweigerlich zur Ausdehnung der Kontrollsphäre und der Beseitigung aller Alternativen in immer mehr Bereichen. Von der Bekämpfung wirklicher Gegner geht der Präsident zur Schaffung solcher Bedingungen über, unter denen erst gar keine Gegner aufkommen können; aus der Bekämpfung realer Gefahren wird bald ein Kampf gegen potentielle oder sogar imaginäre Bedrohungen. Neben dem alternativlosen Präsidenten entstehen erst ein alternativloses Parlament, dann alternativlose Medien usw. Sehr deutlich ist diese Logik in Rußland zu beobachten, wo das präsidiale Regime seit 1991 höchst erfolgreich seine Kontrolle über die Gesellschaft ausgeweitet hat. Doch auch die anderen Regime verfahren ähnlich. Diese Entwicklung hat inzwischen eine Eigendynamik entwickelt und verläuft fast ohne Zutun der Präsidenten. Die Bürokratie treibt sie voran, da sie daran interessiert ist, die Macht des Präsidenten zu festigen. Jeder vom Präsidenten ernannte Beamte bemüht sich, möglichst heftig seine Loyalität zu bekunden und Gefahren für das Regime möglichst wachsam abzuwenden. Dennoch können sich diese Regime offensichtlich auch in eine andere Richtung entwickeln. Unter innerem Druck von der Opposition und äußerem Druck aus dem We-sten kann die Kontrolle über die Gesellschaft in einigen Ländern anscheinend nach Erreichen eines bestimmten Niveaus erschlaffen; der Hang zum Machterhalt kann sich in solchen Situationen in Zugeständnissen an Opposition und Demokratie äußeren. Dies geschah in der Ukraine, wo Kučma, am Sieg seines designierten Nachfolgers zweifelnd (und diesem vielleicht nicht ganz trauend), die präsidialen Befugnisse nicht mehr ausweiten, sondern die Kompetenzen des nächsten Präsidenten im Gegenteil durch entsprechende Verfassungsänderungen beschneiden wollte. Auch in Uzbekistan und Kazachstan gab es solche Perioden der „Liberalisierung“. Eine solche „Liberalisierung“ und „Demokratisierung“ ist immer Fassade, stets geht es dabei darum, das Wesen des Ein-Mann-Regimes zu tarnen und seine Lebensdauer zu verlängern. Dennoch können dadurch günstige Bedingungen für einen Regimewechsel und einen Übergang zur Demokratie entstehen. Machttransfer als Krise Alle Präsidenten müssen sich mit dem Älterwerden auseinandersetzen und ihre eigene Sicherheit sowie die ihrer Familien und Getreuen gewährleisten, indem sie die Macht an eine Person ihres Vertrauens weitergeben. Dabei riskieren sie jedesmal eine politische Krise, da eine Machtübergabe immer den Konflikt zwischen den mit verschiedenen Nachfolgekandidaten verbundenen „Parteien bei Hofe“ zuspitzt und auch die Opposition ermutigt. Natürlich neigen die Präsidenten dazu, die Macht an diejenigen zu übergeben, denen sie am meisten vertrauen: ihren Kindern. Ein-Mann-Regime tendieren ganz natürlich zu Quasimonarchien. Bislang gab es in der GUS erst zwei Fälle einer Machtübergabe an einen vom Präsidenten designierten Nachfolger: in Rußland und in Azerbajdžan. In Rußland stand El’cin kein „geeignetes“ Familienmitglied zur Verfügung, in Azerbajdžan jedoch ging die Macht vom Vater auf den Sohn über. In Kazachstan, Turkmenistan und Uzbekistan ist eine Machtübergabe innerhalb der Familie sehr wahrscheinlich; in Kyrgyzstan wurde sie von der „Tulpenrevolution“ vereitelt. Eine Machtübergabe ist immer mit einer Krise verbunden. Ihr Ausgang kann unterschiedlich sein. Sie kann schlicht mißlingen, wodurch ein Regimewechsel möglich wird. Nicht jedes als Nachfolger oder Nachfolgerin designierte Familienmitglied bringt die für eine Aufrechterhaltung des Regimes notwendigen Eigenschaften mit. Zudem macht eine Machtübergabe an die eigenen Kinder allzu deutlich, daß das Regime einer rechtlichen Grundlage entbehrt, und entzieht dem Nachfolger die notwendige Legitimität. Wenn jedoch die Macht, wie in Rußland geschehen, an einen relativ „neuen“ Mann übergeben wird, der nicht mit den „Sünden“ des Vorgängers in Verbindung gebracht wird, vermag sich das Regime zu festigen und zu „verjüngen“. Eine solche Verjüngungskur hält allerdings nicht lange. Die Lebensspanne autoritärer Regime unterliegt ähnlichen Rhythmen wie die eines Lebewesens. Zu Beginn ist das Regime schwach und unstrukturiert. Dann wird es immer stärker und bekommt klarere Umrisse. Doch auf die Blütephase folgen Alterung und Verfall. Der Niedergang „imitierter Demokratien“ Die Faktoren, die zum Niedergang und Fall „imitierter Demokratien“ beitragen, lassen sich in zwei große Gruppen einteilen: solche, die eher mit der Binnenentwicklung der Regime zusammenhängen, und solche, die eher mit der Entwicklung der Gesellschaften zu tun haben. Beginnen wir mit den Faktoren, die sich aus dem natürlichen Alterungsprozeß der Regime ergeben und unabhängig von jeglicher gesellschaftlichen Entwicklung zum Tragen kommen. Ein wichtiger Faktor ist das Versiegen des Feedbacks. Ein autoritäres Regime ist ein System, in dem den Machthabern allmählich jeder Sinn für die gesellschaftlichen Prozesse abhanden kommt. Je mehr die Wahlen sich in ein Ritual und eine Fiktion verwandeln, je mehr die Medien unter die Kontrolle des Regimes geraten, desto dünner wird der Informationsfluß über die Stimmung der Bevölkerung. Der Präsident umgibt sich mit Menschen, die seine eigenen Ansichten und Vorstellungen über sich und das Land teilen. Ganz natürlich entstehen Persönlichkeitskulte. Besonders groteske Ausmaße hat dieser Vorgang in Turkmenistan angenommen. Aber auch Aliev, Nazarbaev, Karimov, Lukašenka und andere Präsidenten haben ihre eigenen Kulte. Indem sie sich selbst zu alternativlosen Herrschern machen, beginnen die Präsidenten, selbst an die angeblich besonderen Eigenschaften zu glauben, mit denen diese Alternativlosigkeit rechtfertigt wird. Ebenso wie das Umfeld des Präsidenten und die von ihm kontrollierten Medien ihn im Glauben an seinen kolossalen Intellekt und seine besonderen Vorzüge bekräftigen, so bestärken sie ihn auch in der Vorstellung, das Land entwickle sich unter seiner Herrschaft auf das prächtigste, und das Volk lebe im Wohlstand und liebe seinen Präsidenten. Die besonderen Kenntnisse, die der Präsident von seinen Geheimdiensten erhält und die der Gesellschaft nicht zugänglich sind, betreffen nur hochspezifische Teilaspekte der Wirklichkeit. Im wesentlichen macht der Präsident von denselben verzerrten Informationen Gebrauch, die das von ihm geschaffene System auch dem Rest der Gesellschaft liefert: Er sieht dieselben Fernsehprogramme und liest dieselben Zeitungen. Daß die Machthaber in den GUS-Staaten in einer Welt der Illusionen leben, konnte man an dem bizarren Gemisch von Reaktionen während der „farbigen Revolutionen“ beobachten: Die Präsidenten erklärten diese Revolutionen mit boshaften Intrigen aus dem Ausland, gaben sich sicher, daß eine solche Revolution in ihrem Land aufgrund ihrer außergewöhnlichen Qualitäten und ihrer Beliebtheit beim Volk unmöglich seiwäre (so Akaev noch wenige Tage vor seiner Flucht) und fürchteten gleichzeitig, es könne doch auch sie treffen, da auch in ihrem Land geheime Kräfte am Werk seien. Kriminalisierung und Kontrollverlust In „imitierten Demokratien“ spielt die Korruption offensichtlich eine größere Rolle als in undemokratischen Regimen anderen Typs. Ihre Unehrlichkeit ist systemimmanent, da die systematische Verletzung aller verkündeten Grundsätze und verabschiedeten Gesetze zu ihrem Wesen gehört. Dies unterscheidet unsere Präsidenten von traditionellen Monarchen, Militärdiktatoren und selbst totalitären Herrschern, die keiner demokratischen Tarnung bedürfen. Der Präsident ist von den Behörden vor Ort abhängig, die bei Wahlen und Volksabstimmungen seinen Sieg zu gewährleisten haben; von den Richtern, die die notwendigen Urteile gegen seine Widersacher fällen sollen; von den „Oligarchen“, die theoretisch die Opposition finanzieren könnten; von den Generälen, die sich theoretisch in einer kritischen Lage weigern könnten, die Opposition niederzuschlagen; von den Geheimdiensten, die sich insgeheim mit der Opposition verbünden könnten. Da ihm aber die Beziehung zu seinen Untergebenen fehlt, die Militärdiktatoren aus der Armeedisziplin, totalitäre Herrscher aus ihrer ideologischen Verbindung mit dem Machtapparat und Monarchen aus der traditionellen Loyalität schöpfen, ist der Präsident gezwungen, seinen Anhängern materielle Vorzüge zu bieten, sie also zu bestechen. So werden Korruption und Kriminalisierung zu einem Teil des Systems. Dies aber bedeutet einen zunehmenden Verlust der Kontrolle über Staat und Gesellschaft. Die Korruption zersetzt das Kommunikationssystem innerhalb des Staatsapparats. Paradoxerweise nimmt die reale Kontrollfähigkeit des Präsidenten umso mehr ab, je mehr er seine Macht festigt. Laufen die Erlasse des Präsidenten den Interessen des Apparats zuwider, kann dieser sie einfach ignorieren. In einer Krise bricht ein System, das nur durch materielle Interessen zusammengehalten wird, wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Wie die „farbigen Revolutionen“ gezeigt haben, verfügen die Präsidenten über keine echten, überzeugten Anhänger. Im Unterschied zu demokratisch gewählten Präsidenten waren Ševardnadze, Kučma und Akaev in schwerer Stunde auf sich allein gestellt. Selbst El’cin, dem es gelang, die Macht an einen designierten Nachfolger zu übergeben, war sehr schnell von allen vergessen. Das Überleben des Schwächsten Die Korruption zieht den Niedergang der Staatselite nach sich. Doch sie ist nicht der einzige Grund für diesen Verfall: Auch das für diese Regime typische System sozialer Mobilität trägt dazu bei. Niemand wird jemals eine unkontrollierbare, prägnante Persönlichkeit zum Stellvertreter oder unmittelbaren Untergebenen ernennen, die den Vorgesetzten überstrahlen könnte. Daher führt die systematische Dominanz des bürokratischen Typs sozialer Mobilität zu einer systematischen Verschlechterung der Qualität der Elite. In „imitierten Demokratien“ nimmt das bürokratische Mobilitätsprinzip überhand und verdrängt andere Mechanismen. Zu Beginn der 1990er Jahre, als sich das System noch nicht voll ausgebildet hatte, gab es viele Möglichkeiten, ohne die Sanktion der Staatsspitze in die Elite vorzudringen. Diese Möglichkeiten wurden in allen GUS-Staaten von zahlreichen „selbsternannten“ Aufsteigern genutzt. Doch diese Kanäle wurden bald versperrt. Seitdem werden alle markanten Persönlichkeiten, selbst wenn sie den Präsidenten unterstützen, aus dessen Umfeld entfernt. Abgeordnete werden zwar formell gewählt, in Wirklichkeit jedoch ernannt wie andere Beamte auch. Die Plätze an der Spitze der Wirtschaftshierarchie sind bereits besetzt, unkontrollierbare „Oligarchen“ werden beseitigt. So bleiben in der Führungsriege nur die übrig, die von den obersten Machthabern eingesetzt werden. Dies führt zu einem systematischen Niedergang der gesamten Elite. Legitimationsverlust Der natürliche Drang der Präsidenten, ihre Kontrollsphäre auszuweiten, führt dazu, daß demokratische und rechtsstaatliche Institutionen immer unübersehbarer zur Fiktion werden. Die vollkommen voraussehbaren Wahlen verwandeln sich in ein Ritual, ihr Ausgang ist nicht mehr offen. Dabei verfügen die „imitierten Demokratien“ jedoch über keine Legitimationsquelle außerhalb von Wahlen. Ohne den Selbstbetrug der Gesellschaft und ihren Betrug durch die Machthaber haben diese Systeme keine Daseinsberechtigung. Sobald aber die Kontrolle einen bestimmten Grad erreicht, ist dieser Betrug nicht mehr möglich. Denn je größer die Kontrolle des Regimes über die Gesellschaft und je voraussehbarer die Wahlergebnisse, Gerichtsurteile, Medienberichte, desto mehr büßen die Herrscher an Legitimität ein. Diese Verfallserscheinungen würden auch ohne jegliche gesellschaftliche Veränderung eintreten. Doch die Gesellschaft entwickelt und verändert sich. Gegen Ende der Gorbačev-Ära und zu Beginn der postsowjetischen Periode ging auf die Gesellschaften in den GUS-Staaten eine Lawine unerwarteter und unverständlicher Veränderungen nieder. Diese verstärkten das Bedürfnis nach einer „starken Hand“ und schufen einen psychologischen Nährboden für „imitierte Demokratien“. Doch vieles von dem, was damals neu und bedrohlich erschien, ist inzwischen zur Normalität geworden. Die Menschen haben sich an Privateigentum und Marktpreise, an die Abwesenheit einer starren offiziellen Ideologie, an eingeschränkte, aber doch vorhandene politische und bürgerliche Freiheiten gewöhnt. Sie haben gelernt, unter den neuen Bedingungen zu leben, haben sich angepaßt. Dies ist einer der wichtigsten Gründe dafür, daß das Bruttoinlandsprodukt überall in der GUS wächst und der Lebensstandard nicht mehr sinkt. Einerseits ist dies den Ein-Mann-Regimen bis zu einem gewissen Grade förderlich, da es als Beleg für ihre Effektivität gilt und das Risiko spontaner Proteste senkt. Andererseits reduzieren dieselben Prozesse aber auch das Bedürfnis der Bevölkerung nach einer „starken Hand“. Der Faktor Gewöhnung wird durch den natürlichen Generationenwechsel noch verstärkt. Menschen, die noch durch die UdSSR geprägt waren und irgendeine Erinnerung an den stalinistischen Terror hatten, empfanden bereits die spätsowjetische Zeit als milde und liberal, die Liberalisierung unter Gorbačev hingegen als uferlose und gefährliche Freiheit. Für die Jüngeren sind die liberaleren Bedingungen unter den heutigen Regimen etwas Natürliches und Normales. Die in der postsowjetischen Zeit herangewachsene Generation ist psychologisch zweifellos demokratiebereiter als die sowjetische. Das Anwachsen der Opposition gegen die Ein-Mann-Regime hat auch entscheidend mit Veränderungen in der gesellschaftlichen Struktur zu tun. In den vergangenen Jahren ist eine neue bürgerliche Elite herangewachsen, die zwar immer noch vom Staat abhängig ist, aber viel weniger, als es die alte Nomenklatura war. Ein Teil dieser Elite wünscht sich einen Rechtsstaat als Schutz vor behördlicher Willkür. Ein weiteres neues Phänomen ist die Überwindung von Spaltungen innerhalb der Opposition. Anfangs standen dem präsidialen Regime zwei verschiedene Oppositionsgruppen gegenüber, die einander haßten und das Regime im Vergleich zur jeweils anderen Gruppe als das kleinere Übel betrachteten. Dies waren einerseits die Kommunisten und ihre ideologischen und strukturellen Erben und Ableger, zum anderen die antikommunistischen Demokratiebewegungen. Allmählich ändert sich die Lage. Einerseits findet überall, wenn auch je nach Land in unterschiedlichem Maße, eine Transformation der „linken“ Oppositionsbewegungen statt: Indem diese sich von kommunistischen Dogmen verabschieden, begeben sie sich – in anderer Form und unter anderen Bedingungen – auf den Weg, den vor ihnen bereits die ehemaligen Kommunistischen Parteien in Ostmitteleuropa beschritten. Andererseits ist eine gewisse Ernüchterung der antikommunistischen Bewegungen zu beobachten. Gekoppelt mit dem allgemeinen Druck durch die Machthaber ermöglicht dies eine Annäherung zwischen oppositionellen Gruppen verschiedener Couleur auf der Grundlage allgemeiner demokratischer Forderungen. Die Grabenkämpfe gleich machtloser Oppositionsparteien weichen dem gemeinsamen Kampf gegen das Regime um die Einführung neuer „Spielregeln“. Mehr oder weniger organisierte und stabile Allianzen zwischen Sozialisten und Kommunisten einerseits und demokratischen Kräften andererseits sind in Kazachstan, der Ukraine und Belarus entstanden. Auch in Rußland ist eine entsprechende Tendenz sichtbar. Es gibt noch eine Reihe weiterer Faktoren, die zur Schwächung der Ein-Mann-Regime beitragen und Opposition hervorrufen: In der Bevölkerung nimmt der Überdruß über jene Männer zu, die schon seit Jahrzehnten die Zügel in der Hand haben, dazu kommen das Beispiel Ostmitteleuropa und der hohe Entwicklungsgrad der demokratischen Staaten. In einigen GUS-Staaten können diese Faktoren zu einer gewissen Liberalisierung beitragen. Allerdings wird der Übergang der GUS-Staaten zur Demokratie von tiefen politischen Krisen begleitet sein. Denn er ist gleichbedeutend mit einem Machtverlust der Präsidenten (oder von deren designierten Nachfolgern), die allen Grund haben, sich mit sämtlichen Mitteln an die Macht zu klammern, und Systeme geschaffen haben, die einen friedlichen und gesetzmäßigen Machtantritt der Opposition praktisch ausschließen. Es ist leichter, sich einen traditionellen Monarchen vorzustellen, der eine Konstitution einführt, oder einen Diktator, der die Armee in die Kasernen zurückschickt (für beides gibt es zahlreiche historische Beispiele), als einen Präsidenten, der sich ein Ein-Mann-Regime aufgebaut hat und sich dann entscheidet, es seinen eigenen Interessen und Instinkten zuwider und seinen Freunden und Anhängern zum Trotz eigenhändig zu zerstören und so den Sieg seiner Gegner herbeizuführen. Beispiele für eine „Revolution von oben“ hat es in der GUS bislang nicht gegeben. Hingegen sind bereits drei „imitierte Demokratien“ infolge einer „Revolution von unten“ gefallen. Der Fall der „imitierter Demokratien“ und die Perspektiven Bis heute sind auf dem Gebiet der GUS drei als „imitierte Demokratien“ aufgetretene Regime von Revolutionen gestürzt worden. Dies erlaubt einige allgemeine Schlüsse über den Fall solcher Regime. Alle GUS-Länder haben Regime desselben Typs, mit ein und derselben Funktionsweise und Entwicklungslogik. Entsprechend ähneln sie sich auch in ihrem Zusammenbruch: Die Revolutionen folgen einem einheitlichen Szenario. Zunächst einmal waren die drei erfolgreichen Revolutionen und einige mißlungene Versuche (in Azerbajdžan, Belarus, Kazachstan und Armenien) mit Wahlen verbunden. Dies ist natürlich kein Zufall. Wahlen und andere Elemente von Demokratie gehören ebenso zum Wesen dieser Systeme wie die Tatsache, daß es sich dabei um Fassaden handelt. Der Widerspruch zwischen den deklarierten Grundsätzen und der Wirklichkeit ist systemimmanent. Dementsprechend sind Krisen des Systems Folge einer äußersten Verschärfung dieses Widerspruchs und münden in dessen Aufhebung. Die Machthaber führen bei den Wahlen ständig Regie und fälschen deren Ergebnisse, und die Gesellschaft findet sich stillschweigend damit ab. Irgendwann aber zieht sie ihr Einverständnis zurück und vereitelt einen erneuten Fälschungsversuch. Die Menschen gehen auf die Straße und fordern eine Überprüfung der offiziellen Wahlergebnisse. Ein Menschenauflauf auf den Straßen kommt einer Gewaltandrohung gleich. Ein Nervenkrieg beginnt. Der Ausgang des Konflikts hängt von tausend unvorhersehbaren Faktoren ab; im Endeffekt gibt es aber nur drei mögliche Auswege. Im ersten Fall scheuen die Machthaber vor Gewaltanwendung zurück und geben nach, wie in der Ukraine, Georgien und Kyrgyzstan geschehen. Im zweiten Fall scheitert die Gewaltanwendung, da die Armee den Gehorsam verweigert. Dieser Fall ist bis jetzt noch nicht eingetreten, es wird aber wahrscheinlich noch dazu kommen. Im dritten Szenario geben die Machthaber nicht auf und jagen die zahlenmäßig zu schwachen und unzureichend organisierten Demonstranten auseinander. Die ersten beiden Szenarien führen zum Fall des Regimes. Das dritte schiebt diesen nur auf. Es kann keinen Zweifel darüber geben, daß jeder Wahlgang in Azerbajdžan, Kazachstan, Armenien und Belarus von neuen Versuchen der Opposition begleitet sein wird, die Wahlfälschungen zu vereiteln; der endgültige Ausgang ist vorherbestimmt. Früher oder später wird ein solcher Versuch zum Erfolg führen. Revolutionen im Anschluß an Wahlen bzw. an Wahlfälschungen sind in „imitierten Demokratien“ ein natürliches Szenario. Es liegt allerdings auf der Hand, daß sie nicht in jedem Land stattfinden können. Notwendige Vorbedingungen sind die Existenz einer legalen Opposition, ein gewisser Spielraum für gesellschaftliche Selbstorganisation und relativ freie Wahlen. Ab einem gewissen Grad an Härte kann ein solches Szenario nicht mehr zum Einsatz kommen. In Turkmenistan oder Uzbekistan zum Beispiel wäre eine solche Entwicklung kaum denkbar. In diesen Ländern sind die Wahlen so ritualisiert, daß mit ihnen keinerlei Erwartungen mehr verbunden werden. Jegliche legale gesellschaftliche Organisation ist unmöglich geworden. Dies gibt den entsprechenden Regimen einen gewissen Stabilitätsvorsprung, bedeutet aber auch, daß ihr Ende unerwartet und nahezu zweifellos blutig ausfallen wird. Die „farbigen“ Revolutionen sind ein Modell, das in liberaleren Regimen zum Tragen kommen kann; das Gegenstück dazu sind die Ereignisse im uzbekischen Andižan. Entwicklungsvarianten Der Fall der „imitierten Demokratien“ ist nur eine Frage der Zeit. Er kann jedoch zu unterschiedlichen Resultaten führen. Wie bereits angesprochen, ergibt sich der Fall des Regimes aus zwei Prozessen, die zwar miteinander verflochten sind, analytisch jedoch voneinander abgegrenzt werden müssen. Dies ist zum einen der von systemimmanenten Gründen bedingte Verfall des Regimes und zum anderen die Entwicklung der Gesellschaft, für die der politisch vorgegebene Rahmen zu eng wird. Welche Konsequenzen der Zusammenbruch hat, hängt vom relativen Gewicht jedes der beiden Faktoren ab. Bricht das System vor allem deswegen zusammen, weil die Gesellschaft über das Regime hinausgewachsen ist, entsteht eine Demokratie. Dies ist in der Ukraine und – weniger eindeutig – in Georgien der Fall. Ist der Zusammenbruch jedoch Folge des internen Verfalls des Regimes und hat die Gesellschaft dabei noch nicht das Entwicklungsstadium erreicht, das eine stabile Demokratie gewährleisten könnte, so beginnt ein Zyklus einander abwechselnder und gleich instabiler anarchischer Demokratien und Diktaturen, wie in der jüngsten Geschichte vieler Länder der „Dritten Welt“ zu beobachten ist. Dies ist der zwar nicht unvermeidliche, aber doch wahrscheinliche Ausgang der Entwicklung in Kyrgyzstan. Durch den Sturz des Akaev-Regimes ist das Land gewissermaßen zur Ausgangslage von 1990/91 zurückgekehrt. Es ist durchaus denkbar, daß dort nach der derzeitigen Periode chaotischer Demokratie eine neue „imitierte Demokratie“ ähnlich der Akaevs entsteht, genau wie in Indonesien nach dem Sturz von Präsident Sukarno eine neue autoritäre, „imitierte Demokratie“ unter General Suharto errichtet wurde. Möglichkeiten äußerer Einwirkung Die GUS ist nicht nur ein Raum, in dem Länder mit Regimen ein und desselben Typs koexistieren und sich parallel zueinander entwickeln. Es ist außerdem das Gebiet des ehemaligen Russischen Reiches und der UdSSR. Die GUS-Staaten sind historisch und kulturell miteinander verbunden, vor allem durch Rußland und die russische Sprache. Die GUS ist außerdem eine internationale Organisation, die der Einheit dieses Raumes eine Form verleiht und insgeheim, als „latente“ Funktion, dem Erhalt der „imitierten Demokratien“ dient. Die engen Verbindungen zwischen den GUS-Ländern führen dazu, daß Prozesse und Ereignisse, die in jedem dieser Staaten stattfinden, einen unermeßlich größeren Einfluß auf die anderen Länder ausüben, als Prozesse und Ereignisse in Ländern außerhalb der GUS. „Farbige Revolutionen“ beflügeln die Opposition und beunruhigen die Machthaber in jedem Land, während die erfolgreiche Bewältigung einer Krise und die reibungslose Machtübergabe an einen Nachfolger, wie in Rußland und Azerbajdžan, die Präsidenten inspirieren und der Opposition als Warnung dienen. Aus diesem Grund haben die Präsidenten aller GUS-Länder, ganz gleich wie sie sonst zueinander stehen, ein Interesse am Machterhalt ihrer Kollegen und Nachbarn und können in schwerer Stunde mit deren Beistand rechnen. In gewisser Weise ist die GUS der antirevolutionären Heiligen Allianz der gekrönten Häupter Europas in der Zeit nach Napoleon vergleichbar. Es ist ein Bündnis der Präsidenten gegen die Oppositionsbewegungen, in dem Rußlands Präsident natürlich eine zentrale Rolle zukommt. In kritischen Lagen, wenn ihre Macht wackelt, wenden sich die Präsidenten der GUS-Länder an Rußland als ihren natürlichen Verbündeten und werden es auch weiterhin tun. Andererseits sind die demokratischen Länder – mal mehr, mal weniger – bestrebt, die Demokratie auf dem Gebiet der GUS heimisch zu machen, indem sie autoritäre Regime in Schach halten und die demokratische Opposition unterstützen. Deshalb wendet sich jede demokratische Opposition automatisch gegen Rußland und richtet sich prowestlich aus. In der GUS setzt sich – wenn auch auf einem neuen Niveau, mit geringerer Intensität und sanfteren Mitteln – das Ringen fort, daß seinerzeit auf dem Gebiet des „sozialistischen Lagers“ stattfand. Doch obwohl die GUS ein „Schlachtfeld“ zwischen Rußland und dem Westen ist, können beide meines Erachtens das Geschehen in den GUS-Staaten nur sehr eingeschränkt beeinflussen. Rußland kann den Präsidenten der anderen GUS-Länder nur verhältnismäßig bescheidene Hilfe anbieten. Das postsowjetische Rußland ist viel schwächer, als es die UdSSR war, es hängt viel mehr von der Außenwelt ab, und ihm fehlt die zu Sowjetzeiten wirksame ideologische Motivation. Daher kann es den postsowjetischen Regimen keine „brüderliche Hilfe“ der Art antragen, wie sie die UdSSR in Ungarn 1956 und in der Tschechoslowakei 1968 leistete. Die „farbigen Revolutionen“ haben gezeigt, daß Rußland nicht imstande ist, die benachbarten Regime in einer Krisensituation zu retten. Doch auch die Einflußmöglichkeiten des Westens sind begrenzt. Natürlich können die als vorbildliche Demokratien geltenden führenden demokratischen Länder die postsowjetischen Präsidenten von allzu harten autoritären Maßnahmen abhalten, da ihr Urteil für diese Herrscher eine gewisse Legitimationsfunktion besitzt. Doch angesichts einer echten Gefährdung des Regimes tritt dieser Faktor in den Hintergrund. So war zwar der verstorbene azerbajdžanische Präsident Gejdar Aliev durchaus prowestlich ausgerichtet; trotzdem wäre es unvorstellbar gewesen, daß er um seines Ansehens im Westen willen von der Machtübergabe an seinen Sohn Abstand genommen hätte. Zudem war der Demokratisierungsdruck von außen niemals konsequent und kann es wohl auch nicht sein. Die Behörden in den GUS-Ländern können ihn auf ein Minimum reduzieren, indem sie die Schreckgespenster der Destabilisierung und des Extremismus beschwören. In Rußland berief sich das Regime sehr erfolgreich auf die Gefahr einer Machtergreifung durch („rot-braune“) Kommunisten und russische Nationalisten. In Zentralasien ist es der islamische Radikalismus, der diese Rolle spielt. Diese Gefahren sind keine reine Erfindung. Doch werden sie weitgehend durch die Ein-Mann-Regime selbst erzeugt. Wo keine regelmäßigen Machtwechsel stattfinden, wo die Bevölkerung ihre Unzufriedenheit nicht friedlich und legal zum Ausdruck bringen darf, wird der Protest natürlich mithin in extremistische Bahnen gelenkt. So erzeugten und erzeugen in Rußland die Beibehaltung radikaler Bausteine in der Ideologie der Kommunistischen Partei und der Radikalismus der neuen Jugendbewegungen tatsächlich das Risiko, daß im Falle eines Siegs der Opposition ein noch deutlicher autoritäres Regime als das jetzige errichtet wird. Es ist aber klar, daß die radikalen Tendenzen in der rußländischen Politik eng mit dem Wesen des gegenwärtigen Regimes zusammenhängen, das es sowohl für „linke“ als auch für „rechte“ Oppositionsbewegungen unmöglich gemacht hat, auf legale und unblutige Weise an die Macht zu kommen. Indes hat in Moldova, dem einzigen GUS-Staat, in dem kein Ein-Mann-Regime entstanden ist und ein legaler und friedlicher Machtantritt der Opposition nicht ausgeschlossen ist, der Wahlsieg der Kommunisten keineswegs ein autoritäres Regime geschaffen. Im Gegenteil, er hat ein auf turnusmäßigen Regierungswechseln beruhendes System gefestigt und die Transformation der Kommunistischen Partei beschleunigt. Stehen Rußland und Moldova für zwei gegensätzliche Arten des Umgangs mit der Gefahr eines kommunistischen Radikalismus, so verkörpern Tadžikistan und Uzbekistan zwei Methoden der Bekämpfung eines islamischen Extremismus. In Tadžikistan ist die islamische Bewegung trotz eines langen und brutalen Bürgerkriegs nicht extremistisch geworden und integrierte sich nach Friedensschluß in die Gesellschaft. Allem Anschein nach besteht in Tadžikistan heute keine „islamistische“ Bedrohung. Sollte sie aufkommen, so nur infolge einer Transformation von Rachmonovs Regime. Ganz anders in Uzbekistan. Zweifellos ist die Gefahr eines islamischen Radikalismus dort heute weitaus größer als zu Beginn der 1990er Jahre, als die demokratische Opposition noch nicht unterdrückt wurde. Ebenso offensichtlich ist es, daß die Überwachung jeglichen Ausdrucks islamischer Frömmigkeit durch Islam Karimovs Regime die Ausbreitung des islamischen Extremismus förderte. Wenn jemand polizeilich verhört oder entlassen werden kann, nur weil er regelmäßig die Auflagen des Islam erfüllt, ist eine Radikalisierung der Muslime schlicht unvermeidlich. Die Ein-Mann-Regime schaffen einen Teufelskreis: Sie selbst generieren die Gefahr der Destabilisierung und des Extremismus, so daß die demokratischen Staaten sie als das „kleinere Übel“ ansehen und angesichts des Vorgehens des Regimes und der Niederschlagung der Opposition ein Auge zudrücken. Dadurch kann die Gefahr der Destabilisierung und des Extremismus noch anwachsen. Eine zielgerichtete Einwirkung der demokratischen Staaten auf die politische Entwicklung der GUS-Länder kann nur begrenzt Früchte tragen und nur in besonderen Krisenmomenten eine entscheidende Rolle spielen. Eine Demokratisierung der GUS-Staaten kann auch gar nicht Folge äußeren Einflusses sein, sondern sich nur aus internen Prozessen ergeben. Der wichtigste Einfluß, den die demokratischen Staaten ausüben, hat nichts mit bewußten politischen Entscheidungen zu tun. Er besteht in ihrer Vorbildfunktion. So wie das Beispiel der freien Länder die kommunistischen Regime aushöhlte, so üben auch jetzt die Erfolge der demokratischen Staaten, die europäische Integration und die Aufnahme der neuen postkommunistischen Demokratien Ost- und Ostmitteleuropas in die EU einen Demonstrationseffekt aus, der die Ein-Mann-Regime in den GUS-Ländern untergräbt. Aus dem Russischen von Mischa Gabowitsch, Berlin
Volltext als Datei (PDF, 251 kB)