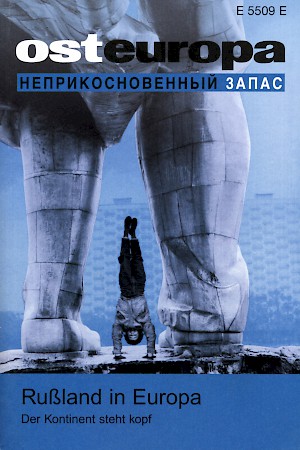Moskau und Berlin im 20. Jahrhundert
Zwei Stadtschicksale
Volltext als Datei (PDF, 1.747 kB)
Abstract
Moskau mit seinen heute zwölf Millionen Einwohnern und Berlin mit seinen 3,5 Millionen blicken zurück auf ein Jahrhundert dramatischer Stadtentwicklung. Darin gibt es viel Übereinstimmung und noch mehr Unterschiede. Beide Städte sind – auf ganz verschiedene Weise – geprägt worden von der exzessiven Dynamik und Gewaltentfaltung des 20. Jahrhunderts; beide sind für eine bestimmte Zeit herausgefallen aus dem Kreis der großen Städte der Welt, beide sind dabei, in ihn zurückzukehren und ihre Rolle neu zu definieren.
(Osteuropa 9-10/2003, S. 1417–1439)
Volltext
Moskau und Berlin im 20. Jahrhundert – zwei Stadtschicksale – das ist ein sehr umfangreiches Thema. Skeptiker könnten auch sagen, so umfangreich, daß es schon ans Vage grenzt. Was kann man sich darunter alles vorstellen? Es könnte um einen Überblick über die Geschichte zweier europäischer Hauptstädte im soeben vergangenen Jahrhundert gehen, was freilich nur als Skizze und tour d'horizon möglich wäre. Auch eine Geschichte der Beziehungen zwischen Moskau und Berlin wäre denkbar, was gewiß auf eine Geschichte der deutsch-russischen Beziehungen hinauslaufen würde. Schließlich wäre beides zusammen denkbar – eine Parallelgeschichte in vergleichender Absicht, die sich immer wieder einander annähert und voneinander abstößt. In meinem Buch über Berlin als Begegnungsort von Russen und Deutschen habe ich eine Vorstellung davon bekommen, wie schwierig es ist, eine angemessene Darstellungsform für ein so reiches, unübersichtliches, aber auch blutiges Kapitel der Beziehungsgeschichte zu finden. Was also tun? Vielleicht wäre es am besten, Bilder zu zeigen: Bilder vom grauen Moskau davor und vom Moskau, das in allen Farben zu strahlen begonnen hat, danach; Bilder vom Schwimmbad Moskva, an dem heute, keine zehn Jahre ist es her, wieder die Christ-Erlöser-Kathedrale steht und jedem Moskauer schon aus der Ferne sagt: Ich war, ich bin, ich werde sein! Und so tut, als sei sie immer da gewesen, obwohl ihre Vorgängerin doch 1932 gesprengt worden war, um Platz für den Palast der Sowjets zu schaffen. Und dann ein Bild vom Marx-Engels-Platz in Berlin, dem früheren Schloßplatz, von dem 1951 das Schloß verschwunden ist, dessen Wiederaufbau bis heute nicht in Gang gekommen ist. Man könnte Bilder von den Baugruben, die in den Moskauer Grund gerissen sind, zeigen, und von den Kränen, die sich im Himmel von Berlin drehen. Und all das gäbe möglicherweise einen genaueren Eindruck von dem, was Berlin und Moskau heute sind, als man es mit Worten evozieren könnte. Daher möchte ich zuerst von den Veränderungen im heutigen Moskau und Berlin sprechen. Es geht dabei nicht um ein vollständiges Bild, sondern gewissermaßen um die Gewinnung eines Aussichts- und Erkenntnispunktes, von dem aus wir den Blick zurückschweifen lassen können auf das 20. Jahrhundert. Der Sinn dieser Operation liegt auf der Hand: Wir bekommen von dort aus etwas anderes zu sehen als im Jahre 1985 oder 1991, als Moskau die radikalen Änderungen noch vor sich hatte, die ihm seither auf schier unglaubliche Weise widerfahren sind. Unsere Wahrnehmung der Geschichte hat ihr Fundament in der Gegenwart: Wir sehen das an einer Stadt, was uns daran interessiert – und das ist in jeder Generation oder jeden Epoche etwas anderes. Zweitens möchte ich einen sehr knappen Durchgang durch das 20. Jahrhundert machen. Wie wurden beide Städte je für sich zum Schauplatz der Jahrhundertgeschichte? Drittens: gibt es etwas, was es erlaubt, beide Städte in einem Zusammenhang zu sehen, gibt es – bei aller Unterschiedlichkeit des individuellen Stadtschicksals – eine Parallelbewegung, eine Zugehörigkeit zu einem Zeit- und Erfahrungshorizont? Schließlich viertens und gleichsam als Postscriptum: Wir kehren zum Ausgangspunkt zurück und versuchen, eine Antwort auf die Frage zu geben, wo die Städte angekommen sind. Moskau und Berlin 2000 Es gibt viele Arten, Städte zu beschreiben. Der erste Eindruck ist immer sehr subjektiv, aber er hat eben die Kraft und Würde des ersten Eindrucks für sich. Was würde ich jemandem zeigen, wenn ich ihm nahebringen wollte, daß sich Großes, Radikales getan hat? Welche Plätze, welche Punkte würden wir aufsuchen, um uns ein Bild zu machen? Worin besteht die Topographie des Wandels, also die Topographie des neuen Berlin und des neuen Moskau? Wohin sollten wir uns auf den Weg machen? Wahrscheinlich kann man nirgends besser als am Potsdamer Platz oder am Brandenburger Tor erfahren, daß alles in Berlin sich geändert hat. Dort, wo vor einem Jahrzehnt noch die Mauer verlief, sind heute kaum noch ihre Spuren auszumachen. Die geteilte Stadt hat sich aufgelöst und ist dabei, sich entlang der Strukturen zu reorganisieren, die die Stadt vor der Teilung bestimmt hatten. Im Stadtbild werden Perspektiven wiederhergestellt, die fast ein halbes Jahrhundert versperrt waren. Es werden Flächen und Brachen bebaut, die erst der Krieg, dann der Säuberungs- und Abrißwahn des Nachkriegs in den Stadtraum gerissen hatte. Zwei Stadthälften, die immer mehr gegeneinander geplant und gebaut worden waren, bewegen sich wieder aufeinander zu. Die Stationen dieser Reorganisation entlang der alten Linien und Strukturen waren fast mit bloßem Auge zu verfolgen: die Beseitigung der Mauer, die Wiederherstellung der Straßenzüge, die Öffnung geschlossener U- und S-Bahnen, die Wiederinbetriebnahme von Gleisen und Bahnhöfen. Fast jeden Tag gab es eine neue Überraschung, die in nichts weniger bestand als in der Herstellung einer Perspektive, die meist eine Wiederherstellung war. Sie vollzog sich an vielen Stellen in der Stadt gleichzeitig, und das Resultat ist eine verwandelte, zur Kenntlichkeit gewandelte Stadt. Selbstverständlich ist die Reorganisation der physischen Topographie – der Straßen, des Kommunikationsnetzes, der beschädigten Fassaden – nur der Index von etwas viel Wesentlicherem: der Reorganisation des Lebens der Stadt selbst. Die Transformation der Stadt ist mit dem bloßen Auge zu erkennen. Das städtische Personal ändert sich ebenso wie die städtische Gesellschaft. Es taucht ein Typus auf, den es in Berlin schon seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hatte und der mit „dem Bonner“ nicht angemessen beschrieben ist. Umgekehrt verschwindet ein Typus oder verliert zumindest seine lange dominierende Stellung. Berlin nach dem Ende der Teilung hat Parties mit anderer spezifischer organischer Zusammensetzung als Inselwest- und Hauptstadtostberlin. Nachteilungsberlin hat Industrien verloren, die sich unter den Notstandsbedingungen der Teilung länger haben halten können als anderswo. Es verschwinden die Biotope, die nur im Windschatten des politischen und wirtschaftlichen Großgeschehens gedeihen konnten. Die Stadt ist in einen neuen Akkumulationsprozeß eingetreten. Sie sammelt die membra disjecta, sofern sie noch greifbar sind. Sie hält Umschau oder Hof. Sie testet, ob sie wieder oder noch mithalten kann im Kreis der großen Städte. Berlin ist dabei, die Nachbarschaften neu zu definieren. Was einmal unerreichbar fern war, ist jetzt nächste Nachbarschaft, und was einmal fast Vorhof war, ist ins Abseits gerückt. Mit dem Koordinatensystem im neuen Europa hat sich auch Berlins Stellung verändert. So könnte man fortfahren, und vor allem könnte man Dutzende und Hunderte von Indizien – mikrologische oder makrologische – für diesen rasanten, alle Aspekte des Lebens betreffenden Wandel anführen. Hier muß ich es bei einer These belassen, in die alle Beobachtungen einmünden. Sie lautet: So spektakulär Tempo, Verlauf und Form dieser Änderungen auch sein mögen, es handelt sich um nichts weiter als das Ende des Ausnahmezustandes und seiner Folgen, um den Wiedereintritt in die Bahn normaler Stadtentwicklung, aus der Berlin aus bekannten Gründen im 20. Jahrhundert herausgetragen worden ist. Die Akzeleration holt in kürzester Zeit auf, was anderswo unter Normalbedingungen Jahrzehnte dauern durfte. Hinter aller Rhetorik des Aufbruchs verbirgt sich doch nur – und das ist durchaus ein Wunder am Ende dieses Jahrhunderts – die Wiederherstellung von Zivilisationsnormalität. Wohin würde man in Moskau gehen, um einen nachhaltigen Eindruck von dem zu gewinnen, was sich in der Stadt im letzten Jahrzehnt getan hat? Man könnte natürlich dorthin gehen, wo jetzt die Goldene Kuppel der Christ-Erlöser-Kathedrale schimmert. Die Vergegenwärtigung dessen, was am Ort geschah, wäre schon eine Moskauer Geschichte des 20. Jahrhunderts. Mächtigstes Gotteshaus der Krönungsstadt – Sprengung 1932 – Projektierung des Palasts der Sowjets bis zu 420 Meter Höhe – Nichtfertigstellung – Anlage eines Schwimmbades – Wiedererrichtung der Kathedrale binnen drei Jahren – das wären kurz gesagt die atemberaubenden Stationen, wobei es natürlich nicht nur um ein Bauwerk und nicht nur um Architekturgeschichte geht, sondern um den Geist des Imperiums und die revolutionäre Leidenschaft der Gottlosenbewegung, die Rücksichtslosigkeit der Utopie und deren Scheitern, die Banalisierung des Kommunismus und die Rückkehr von liturgischem Pomp, die Prachtentfaltung einer Kirche, die sich fast als neue Staatskirche gebärdet, ein Musterbeispiel für gebaute Geschichtspolitik in postsowjetischer und postmoderner Zeit. Aber wahrscheinlich gibt es in Moskau nicht jenen markanten Ort, der dem Ort der Teilung, der Mauer in Berlin, entsprechen würde. Hier zeigt sich doch, daß die Parallellen nur begrenzte Reichweite haben. Moskau war – anders als Berlin – eben nie zerstört durch den Krieg und den Nachkrieg, was immer die Kahlschläge und der Ikonoklasmus von Stalinisten und Antistalinisten angerichtet haben mögen. Moskau war nie eine geteilte Stadt – es sei denn zwischen „denen da oben“ und „denen da unten“. Moskaus Bautätigkeit konzentriert sich nicht auf einen bestimmten Punkt, die ganze Stadt ist im Baufieber – selbst nach der Krise des Jahres 1998. Im Gesamtvolumen dürfte in Moskau derzeit mehr gebaut werden als in Berlin, das sich soviel zugute hält auf seine „größte Baustelle Europas“. Moskau hat in den letzten Jahren flächendeckend gebaut, Haus um Haus, Straßenzug um Straßenzug, Viertel um Viertel – man traut seinen Augen nicht. Moskau hat rasch die Stile übernommen, vielleicht zu rasch und in jedem Falle unkritisch. Aber es geht nicht um Stilkritik, sondern um die Tatsache des Bauwillens selbst, der unbändig erscheint und der auf lange Sicht auch die Bedingung für ästhetische Innovation sein dürfte. Eindrucksvoll ist das dokumentiert in der seit einigen Jahren herausgegebenen niederländisch-russischen Zeitschrift Project Russia. Doch auch hier geht es wiederum nicht um Bauen oder Stadtplanung an sich. Sie sind nur Indikatoren für etwas von größerer Bedeutung, das man bezeichnen möchte als die Stadtwerdung Moskaus, als die Reurbanisierung einer großen Siedlungsagglomeration. Die Indikatoren für die Reurbanisierung sind nicht einmal so sehr die Bauten – dort findet man sogar eher Anklänge an das Empire des alten und neuen Imperiums, an einen monarchischen Eklektizismus –, sondern die Transformation des sovetskij obraz žizni in einen way of life, wie er sich überall in den großen Städten der Welt eingebürgert hat. Die wahren Sensationen in Moskau sind jene, die aus einer sowjetischen eine nichtsowjetische Stadt gemacht haben. Was zum Beispiel? Daß es ein Telefonbuch mit Yellow Pages gibt. Daß es Telefonautomaten gibt, von denen man ins Ausland durchwählen kann. Daß man überall die großen Zeitungen der Welt bekommen kann. Daß viele Dinge, die nie etwas gekostet haben – Brot, öffentliche Verkehrsmittel – endlich ihren Preis haben. Daß man vielleicht mehr zahlen, aber nicht mehr stundenlang in der Schlange stehen muß. Daß es alles gibt – alle Bücher und Schriftsteller, die einmal unzugänglich oder verboten waren; Reisen nach Antalya und Miami Beach; das World Wide Web; das Handy und die Creditcard. Daß es endlich Hauseingänge gibt, um deren Sauberkeit man sich kümmert. Daß man für die Heizung und für Warmwasser endlich bezahlen muß. Jeder, der die sowjetische Metropole noch erlebt hat, ahnt das Glück, das in dieser unspektakulären Transformation liegt. Es wäre hier noch viel zu sagen: über die innerstädtische Migration, die Herausbildung neuer, sozial segregierter Stadtteile, über den Statusgewinn der Altbauwohnungen und den Statusverlust der Hochhäuser in den Vorstädten; über die Transformation der Moskauer multinationalen Gesellschaft nach dem Ende der Sowjetunion; über die Herausbildung neuer business communities und zahlloser Szenen. Über die Entsakralisierung quasisakraler Orte in der Stadt – Roter Platz, Mausoleum – über die Zurückgewinnung des Zentrums durch die Ökonomie – durch Banken und Geschäfte – über die Rezivilisierung und Reurbanisierung städtischer Territorien, die so lange von der Staatsbürokratie belegt und beherrscht waren. Über die Wiederkehr von Cafés, Kneipen und Diskotheken. Worauf es hier nur ankommen kann, ist wiederum die Formulierung einer These. Sie lautet, daß Moskau am Ende des 20. Jahrhunderts dabei ist, wieder eine normale Weltstadt zu werden mit allen Chancen, in die Reihe der Global Cities vorzustoßen. Wie hart, wie extrem, wie paradox der Prozeß auch vor sich gehen mag – das Leben in verschiedenen Jahrhunderten, das Leben in der dollarisierten Metropole einerseits und in der Stadt der limitčiki (Kontingentarbeiter) andererseits – der point of no return ist längst überschritten. Moskau hat den Prozeß seiner zweiten Modernisierung und Urbanisierung hinter sich, die Musterstadt des Kommunismus ist Geschichte – ebenso wie die Sturm- und Drangzeit, die heroische Epoche, aus der sie hervorgegangen ist. Was bekommt man von diesem neuen Berlin und von diesem neuen Moskau aus zu sehen? Was kommt in den Blick, was man zuvor ausgeblendet oder verdrängt hatte? Jetzt, wo eine Epoche der Stadtentwicklung abgeschlossen ist, also Vergangenheit geworden ist, wird eine Vergeschichtlichung oder Historisierung überhaupt erst möglich. Die Städte sind über einen Zustand hinaus, in dem sie bis in die jüngste Zeit hinein gefangen und befangen waren. Die Situation läßt sich eigentlich nicht mit dem Präfix „Wieder“ beschreiben, denn es hat sie vorher nicht gegeben. Berlin ist wieder Hauptstadt – eines neuen Deutschland, wie es noch nie zuvor existiert hat. Moskau ist Hauptstadt eines neuen Rußland, wie es noch nie zuvor existiert hat. Berlin und Moskau – zwei Stadtschicksale im 20. Jahrhundert „Stadtschicksal“ – dieser Titel stammt von Karl Scheffler, dem großartigen Porträtisten des soeben zur Metropole gewordenen Berlin. Er konnte 1910 nicht wissen, wie wahr sich der Terminus vom „Schicksal“ für seine Stadt erweisen sollte. Für Moskau gilt dies nicht weniger: Beide Städte, die so wuchtig und eindrucksvoll die Bühne des anbrechenden 20. Jahrhunderts betreten hatten, sind im Laufe des Jahrhunderts in jeweils ganz eigentümlichen und sehr verschiedenen Prozessen der Selbstzerstörung aus dem Kreis der großen Weltstädte ausgeschieden. In vielem kulminiert in diesen Stadtgeschichten die Geschichte der Länder und Völker, deren Hauptstädte sie waren. Wenn man verstehen will, was geschehen ist, muß man an den Ausgangspunkt zurück, in die Zeit vor dem Jahr 1914, in dem bekanntlich das lange 19. Jahrhundert zu Ende ging. Unsere Schilderung des Endzeit des Ancien régime wird nicht ganz frei sein von Anklängen des Nostalgischen und des Gefühls eines tiefen Verlustes. Berlin und Moskau als europäische Metropolen des 20. Jahrhunderts wurden im 19. Jahrhundert geboren. Die Nervosität, die Fieberhaftigkeit und Kraft der beiden Städte, beide latecomer, wenn auch mit verschiedener Ausgangsposition, wurzeln in der Aufbruch- und Boomzeit des Wilhelminismus und des späten russischen Kaiserreiches. Die Anfänge dessen, was erst nach Krieg und Revolution, also in den legendären zwanziger Jahren, größte Klarheit und radikale Stilisierung gefunden hat, liegen bekanntlich in dem so viel geschmähten „Wilhelminismus“ und im „Silbernen Zeitalter“, dem Rußland die Geburt seiner modernen Nationalkultur verdankt. Woran immer wir denken, wenn wir die Blitze und Donnerschläge der Avantgarde und den neuen Ton hören – es begann alles lange vor 1917 und 1918, lange vor dem Russischen Oktober und dem Deutschen November, die nur Katalysator waren für die Radikalisierung und Findung der endgültigen Form. Keine sowjetische Avantgarde ohne das Silberne Zeitalter, keine Weimarer Kultur ohne Herwarth Waldens Sturm, Peter Behrens, Ludwig Hoffmann. Alles nahm Anlauf in den dynamischen Zeiten, da Rußland vom „Stern Amerikas“ träumte, der über Sibirien aufgehen würde (Aleksandr Blok), und da in Deutschland der massendemokratische Traum vom Platz an der Sonne geträumt wurde. Wir wissen, wie es weiterging. Der Aufstieg der Millionen in ein besseres Leben mündete in den Großen Krieg von 1914, der Kampf um einen Platz an der Sonne führte auf die Schlachtfelder von Verdun und Galizien; die soziale Mobilisierung überschlug sich in der militärischen Mobilmachung, im ersten Massen- und Volkskrieg der Moderne, der seine Vollendung im totalen Krieg keine dreißig Jahre später finden sollte. Berlin und Moskau 1917/1918: Städte der Soldaten, die aus dem Krieg zurückkamen, aber keinen Weg zurück ins zivile Leben fanden. Es dauert gewiß einige Jahre, jedenfalls in Moskau, bis der Kommunismus der Kriegszeit vorüber ist und die Routinen des zivilen Lebens wieder bestimmend werden. Für Moskau sind es Zeiten der Deindustrialisierung, der Regression in vorurbane Zustände. Moskau verliert seine Kaufmannschaft und sein Unternehmertum. In Moskau läßt sich die Macht, der Apparat des neuen Staates nieder. Moskau wird das „vierte Rom“ der Kommunistischen Internationale. Die Situation ist unvergleichlich: Das Moskau des Bürgerkriegs war Bürgerkriegsstadt mit Hungersnot, Entvölkerung, Massensterben, Überlebenskampf; Berlin eher eine Stadt, an der die Revolution trotz der Erwartung eines deutschen Oktobers vorübergegangen ist. Die Unterschiede werden erst recht deutlich, als nach 1920 die Friedenszeit wieder anbricht. Moskau erholt sich rasch, aber es ist doch die Hauptstadt eines Bauernlandes – erst recht nach der Revolution, die den Bauern Land gegeben hat. Im NĖP-Moskau regeneriert sich das mittelständische, kleinunternehmerische, handwerkliche Element sehr rasch. Moskau blüht, wie Basar und Schwarzmarkt nur blühen können. Was soll dieses Moskau mit Berlin, der Hauptstadt eines der am meisten industrialisierten und entwickelten Länder der Welt zu schaffen haben? Berlin hat andere Sorgen. Doch Moskau entgeht den umstürzenden Veränderungen nicht, die mit der forcierten Industrialisierung und Kollektivierung nach 1929 einhergehen. Das Moskau der Kaufleute, des Handels und der Textilindustriellen geht nicht 1917 unter, sondern in dem Strom der bäuerlichen Immigranten, die im Zuge der Kollektivierung, sprich: im Zuge des Wiederauflebens des Bauernkrieges auf dem Dorf in die Städte ziehen oder geschwemmt werden. Das alte, vorrevolutionäre Moskau geht unter in der Woge der Hyperurbanisierung, in der die Einwohnerzahl sich binnen eines Jahrzehnts verdreifacht, wo eine neue Stadtgesellschaft entsteht, ein Riesendorf, das nach Millionen zählt, wo die alte Urbanität aufgelöst, atomisiert, zum Verschwinden gebracht wird. Die harte stalinistische Form, in die Moskau in den 1930er Jahren gebracht wird – der Generalplan von 1935 –, ist die Arbeit zur Strukturierung und Disziplinierung dieser amorphen Masse von Millionen von Entwurzelten. Das neue Moskau: Das ist die Sprengung hunderter Kirchen an exponierten Stellen, die Verbreiterung seiner Gassen und Straßen zu Magistralen und großen Perspektiven; die Zeit der großen Kanal-, Tunnel- und Metrobauten; Moskau wird monumental, großartig. Vorbei sind die Zeiten des Experimentierens mit den bescheidenen und zivil bemessenen Formen des Bauens der 1920er Jahre. Nun geht es um Hierarchie, großartige Prospekte, eine Architektur der Macht und der Einschüchterung, um Steigerungsformen des alten Empire, gipfelnd in der Errichtung des größten Gebäudes der Welt und eines Rings von Wolkenkratzern. Moskau überbietet alle anderen Städte der Welt durch seine Großzügigkeit, seine Planmäßigkeit und Fürsorglichkeit. Aber was als Heimstatt des neuen Menschen geplant war, gerät zur Stadt der Herrschaft, die wohl Sowjetmenschen, nicht aber Bürger gebrauchen kann. Moskau 1937 ist Stadt der umfassenden Umsorgung und des schrankenlosen Terrors, der Filmkomödie und des Zeitvertreibs im neu eröffneten Gor’kij-Park. Es ist die Stadt entfesselter und zum Alltag gewordener Gewalttätigkeit, der Furcht. In Moskau lernt eine ganze Generation das Schweigen und das leise Sprechen, die Mimikry, die Überleben garantiert, das Vokabular, das man beherrschen muß, wenn man weiterkommen will. Das alte Moskau ist untergegangen, ein neues entsteht aus dem Geist der Karriere und der Aufsteiger der 1930er Jahre. Die Erinnerung an diesen beispiellosen Aufstieg von ganz unten auf die Höhen der Macht und des halbwegs sicheren und guten Lebens wird erst mit dem Tod dieser Generation in den 1970er und 1980er Jahren aussterben. Moskau blutet aus und bildet sich neu. Moskau wird arm und zieht aus dem Aufstieg von Hunderttausenden doch unvorstellbar starke Energien. Was ist mit Berlin, das 1933 von der völkischen Revolution umspült und überwältigt wird? Das Leben geht ziemlich normal weiter – außer für jene, die nicht länger zur sogenannten Volksgemeinschaft gehören sollen; das sind relativ kleine, genau definierbare Gruppen von rassisch und politisch Verfolgten: also Juden, Zigeuner, Kommunisten, Sozialisten, bekennende Christen, Homosexuelle – nicht die Gesellschaft als ganze. Die „Volksgemeinschaft“ ist mehr oder weniger ganz dabei. Der Prozeß kann und braucht hier nicht skizziert zu werden. Sein Ergebnis für die städtisch-hauptstädtische Gesellschaft ist klar: Purifizierung, Unifizierung, Homogenisierung, Uniformierung, Verarmung. Berlin nach der Nazi-Revolution und nach der Ruinierung der Stadt ist um seine alten städtischen Eliten gebracht. Sie verschwanden im gesellschaftlichen Abseits, im Exil, in den Lagern, im Gas. Der physischen Ruinierung der Stadt durch die alliierten Bomber – und die Planungen für Speers Germania – entspricht die Zerstörung der Stadtgesellschaft. Berlin muß sich nach 1945 – ähnlich wie Moskau nach 1929 und 1937 – neu bilden. Die Nachkriegszeiten in beiden Städten können als lange Akkumulationsperioden betrachtet werden, in denen die städtischen Gesellschaften wieder zu Kräften kommen, Phasen der Regeneration, die freilich von Prozessen der Auszehrung und Dezimierung konterkariert werden: Das zerstörte Berlin gibt immer noch Kräfte ab – in Flucht, Abwanderung, Auswanderung, Verlagerung, Abwarten. Moskau, das der gespenstischen Spätzeit Stalins entgegengeht, gibt Kräfte ab – an die Provinz, an den Wiederaufbau des verheerten Landes. Aber insgesamt ist die Zeit nach 1945 zwar kein „Goldenes Zeitalter“, wohl aber eines der Regenerierung. Das Wichtigste an diesen Jahrzehnten ist die Abwesenheit von Krieg und die Stabilität, die sich dem Kalten Krieg verdankte. Es ist eine lange Zeit der Demobilisierung, des Nachwachsens der zivilen Kräfte, ein postheroisches Zeitalter, da sich in den Poren der ausgezehrten Hauptstädte wieder Stadtgesellschaft bildet. Das Ende der Diktaturen hat auch den Monumentalismus, die große heroische Geste mit sich genommen. Man will nun Städte für die einfachen Leute – vor allem Wohnungsbau. Über alle Unterschiede hinweg geht ein Orkan des bis zur Banalität uniformen Bauens, des Verzichts auf jede planerische oder architektonische Geste. Was die Diktaturen bei der Zerstörung der historischen Zentren nicht geschafft haben, schafft nun die Expansion des Konsumismus. Historische Restbestände werden geschleift, Unikate pulverisiert. Amerikanismus und Funktionalismus in Vulgärform feiern die deprimierendsten Urstände. Das Resultat, das in den 1960er Jahren endgültig Gestalt angenommen hatte, ist bekannt. Konfrontiert mit diesen traurigen Resultaten einer zweiten, banalisierten Moderne, ja schockiert von ihrem menschen- und stadtfeindlichen Gestus, trieb alles auf eine Wende oder doch zumindest auf eine Suchbewegung zu. Die schöne Stadt durfte wieder gedacht und sogar gebaut werden. Die Wiederkehr der Stadt und der Urbanität war auf die Tagesordnung gesetzt. Daß es um eine tiefgreifende und nicht bloß ästhetische Wendung ging, zeigt sich schon darin, daß eine Wiedergewinnung der Stadt und der urbanen Kultur ohne die Wiedergeburt oder Erneuerung der Bürgergesellschaft, der civil society, gar nicht möglich war. Oder anders ausgedrückt: Das neue Interesse an der Stadt ist zutiefst in der Dynamik der Zivilgesellschaft begründet. Die Zurückgewinnung der städtischen Plätze und Räume ist zu allererst Sache der Bürger und dann auch der Architekten: Also – kein neuer Potsdamer Platz und kein neuer Manegeplatz ohne die politische Revolution des Jahres 1989. Das Resultat dieser Skizze lautet: Berlin und Moskau sind durch die Wucht der gesellschaftlichen und politischen Ereignisse im 20. Jahrhundert aus der allgemeinen Bahn der Stadtentwicklung herausgeschleudert worden. Sie hatten für lange Zeit ihre Rolle als kreative und innovative Zentren der europäischen Existenz und Kultur eingebüßt. Die Zeiten der geschlossenen oder totalitären Gesellschaft waren auch Zeiten der Provinzialisierung und Dezimierung dessen, was Kant die „lebendigen Kräfte“ genannt hatte. Sie brauchten ein gutes halbes Jahrhundert, um dort wieder anzugelangen, wo sie schon einmal – am Beginn des Jahrhunderts – waren. Berlin und Moskau – in der einen Zeitheimat Die Verbindungen zwischen Berlin und Moskau sind offenbar besonderer Art: Sie sind im Jahrhundert der Extreme von großer Nähe und extremer Verfeindung. Vielleicht war die glücklichste Zeit, in der Austausch und Zusammenarbeit auf eine unspektakuläre Weise funktionierten, die Zeit vor dem Großen Krieg, die Stefan Zweig als „Welt von gestern“ geschildert hat. Andere Phasen großer Nähe – die 1920er Jahre – aber auch die Zeit zwischen August 1939 und Juni 1941 sind von ganz anderer Art; es ist immer nur ein Zwischenstopp vor dem erneuten Zusammenstoß. Wie groß der Abstand zwischen Berlin und Moskau im Augenblick der intensivsten Beziehungen zu Beginn der 1920er Jahre auch gewesen sein mag, es gab so etwas wie eine gemeinsame Gegenwartserfahrung: die isolierte Stellung innerhalb der internationalen Staatenwelt einerseits und die sozialen, politischen und mentalen Erschütterungen nach Weltkrieg und Revolution andererseits. Russen, die in die Stadt gekommen waren – ob als Flüchtlinge oder als zeitweilige Emigranten mit rotem Paß – mußte die Reichshauptstadt erscheinen wie ein großes Déjà vu: Elend, Hunger, Aufstandsbewegungen, Putschversuche von rechts und links, rasch sich ablösende Regierungen, eine demoralisierte Nation – all dies kam ihnen vertraut vor. In Berlin, das viele noch aus der Vorkriegszeit gekannt hatten, schien alles möglich zu sein; Berlin, eine offene Stadt. Viele hatten hinter sich, was Berlin noch bevorzustehen schien. Das Fundament der deutsch-russischen Begegnung ist daher die Gleichzeitigkeit einer Erfahrung, Berlin und Moskau gehörten, wie Ehrenburg sagte, der „gleichen Zeitheimat“ an. Aber die Allianzen, die sich bilden, sind Allianzen von Entwurzelten, sie sind inspiriert von gänzlich verschiedenen, wenn nicht unvereinbaren Ambitionen. Berlin ist für Sowjetrußland seit Rapallo das Tor zum Wiedereintritt in die internationale Staatenwelt, Berlin ist aber auch der Vorposten der Kommunistischen Internationale, die dereinst in Berlin ihr Hauptquartier aufschlagen soll. In Berlin geht die diplomatische Oberwelt ein und aus, aber Berlin ist auch das Zentrum einer grenzüberschreitenden Unterwelt von Geheimdiensten und Konspiration. In Berlin haben die geschlagenen Weißen Armeen ihre Residenten und Werber, eine ganze Armee im Wartestand, mit besten persönlichen Beziehungen zu deutschen militärischen Kreisen noch aus Vorkriegstagen. Aber Berlin ist gleichzeitig der Punkt, wo sich Instrukteure und Generäle der Roten Armee ein Stelldichein geben, zu gemeinsamen Übungen mit der Reichswehr bei Frankfurt an der Oder reisen. Berlin ist der Schauplatz einer terroristischen Parallelaktion: Hier wird ein Führer der russischen Liberalen in der Emigration, Senator Vladimir Nabokov, am 28. Februar 1922 ermordet und am 24. Juni 1922 Walther Rathenau – im einen Fall von russischen, im anderen von deutschen rechtsextremistischen Terroristen, und zwischen beiden gibt es Verbindungen. In Berlin trifft sich alles, was in der modernen russischen und deutschen Kultur mit der Arbeit der Aufklärung verbunden ist, aber in Berlin wirkt auch eine Sehnsucht nach einem „heiligen Rußland“, das es nicht mehr gibt, und von dem man glaubt, es sei das Opfer einer großen Verschwörung geworden. In Berlin treffen sich die Anführer der Pogrome auf russischem Boden – und ihre Opfer, die in Berlin Zuflucht gefunden haben. In Berlin treffen sich die reifen Künstler des russischen Silbernen Zeitalters, aber auch ihre futuristischen Herausforderer – so wird es zum exterritorialen Begegnungspunkt einer gespaltenen russischen Moderne. Deutsche Kreise hatten die Reise im plombierten Waggon organisiert, um das Zarenreich zu schwächen; jetzt wollen oft dieselben Leute mit den Nachfolgern des Zarenreiches ins Gespräch kommen. Die Russian Connection ist nicht nur ein heißer Punkt der Kreativen, sondern ein mixtum compositum, ein problematisches und hochexplosives Gemisch. Diese Szene ist in ihren Verbindungen und Vernetzungen noch lange nicht erforscht – sicher scheint mir nur, daß ihnen mit den simplen Begriffen der politischen Lagerbildung nicht beizukommen ist. Ein einfacher Blick genügt: Es waren eben nicht nur, vielleicht sogar nicht einmal in erster Linie, die Sympathisanten des Bolschewismus oder der Sowjetmacht, die die Rettung aus dem Osten erwarteten, sondern eher jene, die an der Restitution der alten Ordnung, an der Wiederherstellung der Reichszusammenhänge interessiert waren, denen das Licht eher aus dem Osten zu kommen schien als aus dem Westen, dem Hort einer kulturfeindlichen Zivilisation, des Geldes und der Presse. Der Kernpunk dieser konservativ-restaurativen Russophilie war außenpolitisch die Revision der Grenzen, sprich das Verschwinden der zweiten polnischen Republik. Dem Dostojevskij-Fan Moeller van den Bruck, überhaupt vielen „linken Leuten von rechts“ war auch ein rotes Rußland näher als ein Westen, der mit dem „System von Versailles“ und mit der modernen Zivilisation identifiziert wurde. Umgekehrt erwiesen sich die Mitgenossen aus den Jahrzehnten der II. Internationale als unversöhnliche Gegner: die deutsche Sozialdemokratie mit ihrem Bolschewismushaß. Auf den Berliner Bühnen war ein eigentümlicher russischer Kulturkampf zu beobachten, zwischen der vorrevolutionären Theaterkunst und dem Theater des neuen Rußland, zwischen der Filmkunst, die das späte Zarenreich hervorgebracht hatte, und dem Sowjetkino, das die Welt eroberte. Zu dieser gemeinsamen Zeiterfahrung gehörte die Erfahrung, daß Sowjetrußland nicht außer Reichweite lag, kein Exotikum war. Sei es per Deruluft vier Mal wöchentlich über Königsberg und Riga, per Schiff über Stettin oder per Ost-West- beziehungsweise Nord-Expreß. Das bedeutete, es gab einen Strom von Leuten, die das Land selber in Augenschein nehmen konnten, und fasziniert oder desillusioniert zurückgekehrt waren; Walter Benjamin ist nur einer von ihnen, Oskar Maria Graf, Klaus Mann, Arthur Koestler und viele andere gehören dazu. Das bedeutete, in der Stadt gab es einen weit über die Parteigänger des Kommunismus hinausreichenden Resonanzraum für sowjetische Angelegenheiten: für Literatur, Sozialpolitik, Pädagogik, Filme, Kunst, Theater, Soziologie und marxistische Ästhetik. Daneben gab es jene Milieus, die schlicht an der Wiederaufnahme normaler Beziehungen interessiert waren: der rußlanderfahrene AEG-Chef Felix Deutsch, der einflußreiche Otto Hoetzsch von der Berliner Universität, die Abmachungen zwischen den Bibliotheken zum Bücheraustausch, die Zusammenarbeit von Naturwissenschaftlern oder die Organisierung gemeinsamer geologischer Expeditionen. Es gab kaum jemanden, der nicht beeindruckt war von der Frische und der Kraft des neuen Rußland, und man meinte, vorerst ein Weniger an Kultur oder an Zivilität in Kauf nehmen zu können. Genau besehen ist es eigentlich gar nicht zutreffend, daß Berlin ein Treffpunkt war, sofern man damit einen Ort meint, wo sich Fremde treffen. Jene, die sich in der Bewältigung der Krise trafen, stammten aus einer Welt, die allen gleichermaßen noch vertraut war, allesamt waren byvšie ljudi, ehemalige Leute, Menschen von gestern. Sie teilten nicht nur den gemeinsamen Horizont von Krieg und Revolution, sondern die Erfahrung der Epoche, die jenen vorausgegangen war, die Erziehung, den Stil und die Lebensweise, mit denen man in der Welt von gestern noch aufgewachsen war. Die Begegnung der 1920er und 1930er Jahre lebte noch ganz und gar von dem zivilisatorischen Sockel, der sich in der Vorkriegszeit gebildet hatte. Alle, die sich in der Nachkriegs- und Nachrevolutionszeit begegneten, stammten aus einer noch ungeteilten Welt, in der gemeinsame Standards, gemeinsame Normen – wenn man so will, ein gemeinsames Referenzsystem gegolten hatten. Wenn man von Berlin als dem Begegnungspunkt von Russen und Deutschen spricht, dann heißt dies vor allem, von den Fundamenten vor der großen Katastrophe des Ersten Weltkriegs zu sprechen. Freilich ist nicht immer Berlin das Zentrum, das das junge Rußland anzieht, es kann auch das Marburg Hermann Cohens, das von Pasternak aufgesucht wird, das Freiburg Heinrich Rickerts und Wilhelm Windelbands und das Heidelberg Max Webers sein, wo sich Nikolaj Berdjaev, Fedor Stepun oder Osip Mandelštam eingefunden hatten. Es kann das Darmstadt der Mathildenhöhe und der Technischen Universität sein, an dem große russische Ingenieure und der große El Lissitzky studiert hatten. Oder es ist die Technische Hochschule Charlottenburg, die russische Ingenieure ausgebildet, die AEG, die Leonid Krasin, den späteren Volkskommissar zum Generalvertreter für das Russische Reich gemacht hatte, oder die Friedrich-Wilhelms-Universität, wo vor dem Ersten Weltkrieg an die 150 Studenten und Studentinnen aus dem Russischen Reich eingeschrieben waren, darunter Geistesgrößen wie Vjačeslav Ivanov oder der künftige Volkskommissar für Äußeres Maksim Litvinov. Alte russische Reiseführer belegen, daß es einen regen russischen Deutschland- und Berlin-Tourismus gegeben hat – lange vor Majakovskijs berühmten Gedicht auf das KaDeWe, daß das Hotel russe in der Friedrichstraße der erste Halt für die Besichtigung der Reichshauptstadt gewesen war, bevor man weiterfuhr nach Elsterwerda, Teplitz oder Bad Ems. Russen kannten sich in Berlin aus, Vladimir Uljanov in der Königlichen Bibliothek, Osip Pjatnickij, der für den Schmuggel revolutionärer Literatur zuständig war, im Wedding, der Dirigent Sergej Kusevickij in der Philharmonie. Es ist das eher unauffällige Funktionieren von Geschäfts- und Reiseverbindungen, die Existenz von Bankfilialen, die Anwesenheit von Zeitungskorrespondenten, ein Einkaufstourismus und ein Gastspielwesen, die für die Existenz einer gelebten und relativ störungsfreien Verbindung sprechen. In einer solchen Welt gedieh eine Kultur, die den Kulturaustausch noch nicht nötig hatte, wenn sie sich verständigen wollte. Dies war der Raum, in dem transnationale Eliten heranwachsen konnten, und es ist klar, woraus diese sich am ehesten rekrutieren konnten: aus den alten dynastischen Verbindungen, aus der Formenwelt der Diplomatie, aus einer internationalistischen Sozialdemokratie und aus dem Judentum. In der Welt der Reiche von gestern war ein polyglotter, kosmopolitischer, transnationaler Kader herangewachsen, eine „Diskursgemeinschaft“, die in den folgenden Jahrzehnten von Nationalismus und sozialer Revolution aufgerieben werden sollte. Die Personifizierungen dieser transnationalen Eliten lassen sich unschwer im Berlin der Zwischenkriegszeit benennen. Auch die Sowjetmacht war, trotz ihrer revolutionären Gebärden, eine Macht, deren diplomatisches Personal noch in der Vorkriegszeit aufgewachsen war und den Kodex der Formen des 19. Jahrhunderts, wenn schon nicht akzeptierte, so doch beherrschte. Ein adliger Volkskommissar Georgij Čičerin und ein aus dem Adel kommender Botschafter in Moskau, Graf Brockdorf-Rantzau, behielten ihre ungewöhnlichen Allüren und ihre Leidenschaft für klassische Musik auch unter revolutionären oder demokratischen Umständen bei. Karl Radek, dieser Prototyp des weltrevolutionären Akteurs, fand sich überall zurecht: in Lemberg, Moskau, Wien und Berlin, er fand sogar den Ton, der die nationalistische deutsche Rechte in Versuchung führte. Es gab keine Probleme zwischen Rainer Maria Rilke und Leonid Pasternak, denn ihre Bekanntschaft war älter und tiefer begründet als die Revolution. Nikolaj Berdjaev und Grigorij Landau konnten sich ohne Schwierigkeiten in den Diskurs über Spenglers Untergang des Abendlandes einschalten, denn sie hatten die entscheidende Debatte darüber noch in Moskau geführt und sich eine eigene Position dazu erarbeitet, etwa in Sumerki Evropy. Für Harry Graf Kessler war die Begegnung mit dem enteigneten russischen Pressezaren Ivan Sytin kaum etwas Exotisches, denn Sytin war jährlich vor dem Weltkrieg zur Leipziger Buchmesse gekommen. Für die Men’ševiki, die Zuflucht in Berlin gefunden hatten, gab es gute alte Bekannte aus der Zeit der II. Internationalen, und Grundsätze, an denen man der programmwidrigen Revolution in Rußland zum Trotz festzuhalten gedachte. Überall trifft man auf Bekannte aus alten Tagen – im diplomatischen Corps ebenso wie unter den Generalstäblern (Hilger, Nadolny, Niedermayer). Überall sind Vermittler zur Stelle, die von Hause aus zur deutschen Kultur genauso gehören wie zur russischen – viele Deutschbalten sind darunter, Moskauer Reichsdeutsche wie Arthur Luther oder Klaus Mehnert, die als Übersetzer oder Journalisten tätig sind. Die Zerstörung der Beziehung zwischen Moskau und Berlin in den folgenden Jahren ist identisch mit der Auflösung des Erfahrungsraums und des personellen Kaders, der jenen getragen hatte. Er geht in mehreren Schüben vor sich – beginnend 1914 und sich steigernd bis in den Zusammenbruch von 1945. Dieser Zusammenhang wird mit dem Ersten Weltkrieg gesprengt, er findet sich noch einmal als der Träger der Begegnung der 1920er Jahre, er wird abgelöst durch den Aufstieg der Massen, die in den totalitären Parteien ihre Stoßtrupps finden. Das kulturelle Hauptresultat des Scheiterns der deutsch-russischen Beziehungen ist die Auflösung, Atomisierung, Vernichtung jenes von einem gemeinsamen Erfahrungshorizont geprägten Trägers deutsch-russischer Beziehungen. Bevor es zum großen Finale im Zweiten Weltkrieg kommt, sind die alten Eliten bereits ausgebootet oder massakriert – ob es sich nun um die alte revolutionäre Garde in Rußland handelte oder um die Diplomaten alteuropäischer Schule. Ein neuer Phänotyp, der nichts mehr weiß von diesem gemeinsamen Horizont, betritt die deutsch-russische Szene. Man muß nur den Spuren nachgehen, wo die Vertreter der Russian Connection abgeblieben sind. Marschall Tuchačevskij, der Mitgefangene de Gaulles in Ingolstadt im Ersten Weltkrieg, endet mit den anderen Generälen auf Deutschlandbesuch als Spion vor dem Moskauer Militärtribunal, während die deutschen Generäle, die ihre Ortskenntnis bei Manövern in Rußland erworben hatten, davon Gebrauch machen werden in den Vorbereitungen zum Unternehmen Barbarossa. Botschafter von der Schulenburg, der Berliner Konsul im Zarenreich, der im Pakt von 1939 noch den rettenden Ausweg aus dem Krieg gesehen hatte und 1941 die sowjetische Führung vor dem Angriff warnt, wird in Plötzensee unter dem Strang enden. Richard Sorge, der enthusiastische Student der Berliner Universität und des Frankfurter Instituts für Sozialwissenschaften, wird als Spion in Tokio hingerichtet werden. Ein einflußreicher antibolschewistischer Russophiler wie der Schriftsteller Edwin Erich Dwinger, Kind einer deutsch-russischen Ehe, dessen Bücher zum Bolschewismus in Massenauflagen in den 1920er Jahren erscheinen, wird mit der SS in die Sowjetunion fahren und auch noch nach dem Krieg in Westdeutschland ein einflußreicher und angesehener Schriftsteller sein. Die Men’ševiki haben sich nach Übersee gerettet und bauen die amerikanischen Soviet Studies auf. Berlin wird im Zweiten Weltkrieg Metropole der russischen Zwangsarbeiter und zum Gefängnis des Generals Vlasov – Berlin-Dahlem, Kiebitzweg 3. Berlin wird zum Verschiebebahnhof für die Landser auf dem Weg nach Vitebsk oder Stalingrad und zum Endpunkt des „Sturms auf Berlin“. Vom Berlin des Aufbruchs in die Moderne ist nichts geblieben als ein Memento und Millionen von Menschenleben, fast 30 Millionen Tote in der Sowjetunion, ein Land in Trümmern. Damit ist etwas zu Ende. Wenn es einen Zeithorizont gibt, der aus der Sicht der Heutigen fürwahr utopisch anmutet, dann ist es die geglückte Zeit einer unspektakulären Moderne der Vorweltkriegszeit vor 1914. Die großen Leistungen der deutschen und sowjetischen künstlerischen Avantgarden der 1920er Jahre sind zugleich Zeugnisse einer kulturellen Überhitzung, der Krise, der Verzweiflung. Vieles spricht dafür, daß sie sich erschöpft hatte, bevor die Diktatoren ihr den Todesstoß versetzt oder für sich instrumentalisiert hatten. Erklärungsbedürftig ist ja nicht so sehr, warum die Gewalt gesiegt hat, sondern warum die Kräfte, die ihnen hätten wehren können, zu schwach waren, um sie in Schach zu halten. Die Russian Connection, so unvorstellbar reich sie für uns Heutige in jeder Hinsicht war, wurde zerrissen von gegensätzlichen Interessen und strategischen Ambitionen, zu uneinheitlich und fragmentiert, als daß sie innerhalb der Tumulte der Epoche einen Ruhepunkt oder gar ein konsolidiertes Zentrum gegen die Bedrohungen der Revolutionen von oben und von unten hätten abgeben können. Die Ausschaltung und Liquidierung der zivilen Kräfte – seien es aristokratische Diplomaten, Intelligencija-Revolutionäre, deutsche Antifaschisten in Moskau, menschewistische Antibolschewisten im deutschen Exil oder patriotische Militärs – sie alle sind an die Wand gespielt worden, und der Weg war frei für etwas, was es im deutsch-russischen Verhältnis bis dahin nicht gegeben hatte, ich würde auch sagen: für das Ende der deutsch-russischen Beziehungen im alten Sinne. Postscriptum? Es führt kein Weg zurück in die Vorweltkriegsepoche, und es gibt keinen Grund, Berlin als deutsch-russischen Treffpunkt in der ersten Jahrhunderthälfte zu romantisieren. Am Anfang steht nach 1945 für viele die Erfahrung der Befreiung, aber für noch mehr die gemeinsame Erfahrung von Krieg, verbrannter Erde, Gefangenschaft. Es folgen die Erfahrungen des Kalten Krieges, der Teilung, die zwei verschiedene Lebens- und Erfahrungshorizonte mit sich gebracht hatte. Berlin wurde eigentlich erst im Moment der Teilung der Welt zu einem Treffpunkt im strengen Sinne: Hier trafen sich Leute, die vorerst keine gemeinsame Erfahrung mehr verband außer jener negativen. Berlin, das als Stützpunkt einer intakten Kommunikation ruiniert worden ist, lädt sich – so lautet jedenfalls meine Hoffnung – mit neuen Kräften auf. Vieles ist nachgewachsen, insbesondere in den vierzig Jahren auf dem Territorium der DDR, aber auch in dem, was einmal BRD war. Auch die Teilungszeit hatte ihre deutsch-russischen Pioniere. Für jene Generation, die in den Horizont nach 1989 hineinzuleben begonnen hat, ist die Lage gänzlich anders. Wir wohnen der erneuten Herausbildung eines gemeinsamen Erfahrungs- und Lebenshorizonts bei, und die Frage ist, ob die jetzige Generation mit den Problemen besser fertig wird als die Zeitgenossen eines heroischen Aufbruchs und die Zeitgenossen von dessen Zusammenbruch. Berlin und Moskau, respektive Deutschland und Rußland sind mit dem Schwierigsten nicht fertig geworden: der Bewältigung der Normalität. Ob es nun anders werden wird – niemand kann es wissen.
Volltext als Datei (PDF, 1.747 kB)